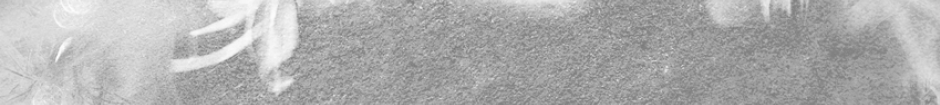
23. Dezember 2021
Der Aufstand der Massen
Von José Ortega y Gasset
Übersetzt ins Deutsche von Helene Weyl
Erstmals erschienen 1931 in der DVA Stuttgart
Rasse heute, schrieben Adorno und Horkheimer 1944 (in Dialektik der Aufklärung), ist die Selbstbehauptung des bürgerlichen Individuums, integriert im barbarischen Kollektiv. Und 15 Jahre zuvor schrieb Ortega y Gasset: „Es gibt keinen Helden mehr; nur noch den Chor.“ Seit dem berühmten Buch von Gasset hat sich die Weltbevölkerung mehr als verdreifacht. Aber nicht über diese Masse als Wachstum schrieb Gasset sein Essay. Die Individuen, die diese Mengen bilden, gab es vorher, aber nicht als Menge. Gasset spricht von der Sichtbarwerdung der Masse. Damit ist seine Analyse näher an Adorno als an Spengler (den Gasset auch im Text stark kritisiert). Gasset definiert den Massenmenschen als jemanden, der sich nicht selbst einen besonderen Wert beimisst, sondern sich für Durchschnitt hält und damit auch wohl fühlt, der selbst gar nichts Besonderes sein will, sondern wie alle anderen. Der elitäre Mensch unterscheidet sich so naturgemäß vom Massenmenschen als jemand, dessen Streben sich vom Durchschnitt entfernt. Der durchschnittliche, der gewöhnliche Mensch hat sich zu einer Art herrschaftslosen Herrschaftsform entwickelt. Der damit verbundene Stillstand ist vor allem ein Stillstand der sittlichen Entwicklung. Wenn es keine sittliche Entwicklung gibt, dann verfallen die Sitten. Gewohnheiten erstarren zu unverständlichen und zwanghaften Ritualen. Rituale, die keine Zeremonienmeister mehr haben. Darin ist ein komplexes Problem verankert, denn der gewöhnliche Mensch verfügt nicht über die nötigen Führungsqualitäten, da er nichts Besonderes will. Er ist per Definition amoralisch. Seine Moral definiert sich durch seinen Gehorsam. Gasset definiert im letzten Abschnitt seines Essays, was einen Staat ausmacht und was den modernen Staat von den antiken Stadtstaaten unterscheidet. Der moderne Staat gleicht einem multinationalen Unternehmen mit einem Expansionsdrang. Die Ziele des Staates liegen außerhalb seiner selbst. Doch sobald ein Staat sich mit sich selbst befriedet und keine Expansionsidee mehr hat, sich auf nationalistische Motive einlässt, beginnt seine eigentliche Dekadenz. Der gewöhnliche Mensch, der Massenmensch hat selbst keine Ziele, keine Motivationen die ihn antreiben. Er benötigt laut Gasset daher eine Führung, er benötigt Herrschaft und geht dann im Gehorchen auf. Dieses Gefüge, das in den Stadtstaaten durch die Sklaverei dargestellt war, konnte nicht halten. Im Gegensatz zum modernen zukunftsorientierten Staat, waren die antiken Stadtstaaten (Hellas, Rom) stärker an der Vergangenheit orientiert. Wenn wir unsere Nation verteidigen, verteidigen wir unser Morgen, nicht unser Gestern, schreibt Gasset über den modernen Staat. Da aber die Stadtstaaten nicht dynamisch waren (Rom war als ewige Stadt konzipiert), wurde der Status quo verteidigt und der ergab sich in den antiken Stadtstaaten eher durch die Reliquien der Vergangenheit, als durch zukünftige Operationen. Daher konnte Rom Cäsar auch nicht verstehen.
Die Gewöhnlichkeit, die Ziellosigkeit des modernen Massenmenschen ist ein Mangel an Inspiration. Andererseits – und diesen Teil seiner Analyse darf man nicht übersehen – ist die moderne Welt von unendlichen Möglichkeiten erfüllt und strotzt nur so von wirtschaftlicher, kreativer und wissenschaftlicher Vitalität. Gerade dies hat sich in den vergangenen hundert Jahren seit dem Aufstand der Massen bewiesen. Das Problem dieser Vitalität ist der Überschuss. Der Überschuss an Zukunft. Eine derart dynamische Gesellschaft verfällt ohne unternehmerischen Spirit, ohne Betätigungsfeld für die vorhandene Kraft in Melancholie. Der Zunahme an Lebensquantität und Intensität fehlen die nötigen Werte, die Qualität. Es geht – schreibt Gasset – dieser Gesellschaft wie dem Herzog von Orleans, von dem man während seiner Regentschaft für Ludwig XV. sagte, dass er alle Talente besitze außer dem einen, sie zu benutzen. Der moderne Staat ist – nach Gasset – die Einladung menschlicher Gruppen zur gemeinsamen Ausführung eines Unternehmens. Daher ist der moderne Nationalstaat in seiner Wurzel demokratisch (und das ist entscheidender als alle Unterschiede der Regierungsform). So ist auch die Herrschaftsform durch das Plebiszit des vorherrschenden Volkstypus geprägt. Und das Volk des 20 . Jahrhunderts war ein Durchschnittsvolk. Man kann das heute noch dramatischer feststellen. Der Politiker des 21. Jahrhunderts verkörpert nicht nur den Idealtyp des gewöhnlichen Durchschnitts, er verkörpert auch die dysfunktionale Ideenlosigkeit eines mit effizienter instrumenteller Vernunft ausgestatteten Menschen. Wissenschaftlicher Fortschritt – lautet die bislang nicht widerlegte Ortega-Hypothese – beruht auf der Arbeit von allen Wissenschaftlern, d. h. vor allem auch auf der Arbeit einer großen Masse von Wissenschaftlern mit mittelmäßigem Talent, die nur weniger bedeutende Ergebnisse erzielen würden, wobei die Summe all dieser kleineren Fortschritte aber einen wesentlichen Teil des gesamten wissenschaftlichen Fortschritts ausmache. Der Ameisenstaat aus Spezialisten zerstört mit seinem Partikularismus das Ganze, dekonstruiert den Überblick, den ein Universalist zu haben glaubt. Das Problem bei der Analyse von Gasset ist keine Frage der Beweisbarkeit. Ideen sind seit Kant immer regulativ. Es geht nicht darum, welches Ordnungsprinzip im Recht ist, sondern darum überhaupt eine Ordnung vorzufinden. Die Überkomplexität von industriell geprägten Gesellschaftsformen lässt ein Allgemeines kaum noch zu. Die Homogenität eines Staatsgebildes bildet danach eine natürliche Grenze. Der Massenmensch hat diese Grenze längst überschritten. Seine Spezialisierung weist außerhalb seiner Betätigung weder Homogenität auf, noch Kontinuität. Es ist in der Tat bloße Negation (denn dieser Mensch repräsentiert keine neue Zivilisation, die mit der alten in Kampf liegt, sondern eine bloße Verneinung). Der Massenmensch nimmt sich Meinungen heraus und bildet sich keine mehr. Denn er vermisst nichts, was über seinen Horizont hinaus geht. Das Prinzip der Verstockung bedeutet, dass der Massenmensch mit seinem Vorrat an Ideen zufrieden ist. Das zeichnet den Massenmenschen als einen dummen Menschen aus, dass er seine eigene Narrheit nicht erkennt und sich – so begrenzt er ist – für gescheit hält. Lichtspiele und Rundfunk brauchen sich nicht mehr als Kunst auszugeben. Die Wahrheit, daß sie nichts sind als Geschäft, verwenden sie als Ideologie. Dieser Satz über die Kulturindustrie von Adorno und Horkheimer trifft auch auf die Bildungsindustrie zu. Bildung ist ein Geschäft. Der Massenmensch ist vornehmlich Konsument, Verbraucher. Der Mangel an Geist wird durch einen Überschuss an Produktion kompensiert. Ortega y Gasset konnte oder wollte die ökonomische Realität der Massenökonomie nicht wahrnehmen, nicht die Warenhaftigkeit des Seins. Das hätte ihn genötigt, dem Kommunismus das Wort zu reden. Aber man muss heute kein Kommunist sein, um den Kapitalismus als apokalyptisches Drama zu kritisieren. Nur – und das ist das Problem von dem Gasset schrieb – uns fehlt eine Idee, es anders zu machen. Zu sehr hat sich inzwischen die Autopoesie der Ökonomie in die Mechanik der Gesellschaften eingefressen. Sich eine wachstumslose Wirtschaft nur vorzustellen, stellt sich bereits widersinnig zu unserem Ökonomiebegriff. Wirtschaft und Wachsen sind eine Worteinheit geworden. Gasset attestiert dem Massenmenschen sittlichen Verfall und Amoral, weil ihn die Prinzipien der Kultur kalt lassen und er sich lieber für Automobile und Anästhetika interessiert. Die Welt ist zivilisiert, aber ihre Bewohner sind es nicht; sie sehen nicht einmal die Zivilisation an ihr, sondern benutzen sie, als wäre sie Natur. Gasset erkennt tiefgründig, dass dieser moderne Mensch die von Menschen hergestellte Welt für die eigentliche Welt hält und nicht die Natur selbst. Er verwechselt natura naturata (hergestellte Natur) mit natura naturans (sich selbst schaffende Natur), um es mit diesen aus der Scholastik stammenden Begriffen zu kennzeichnen. Das tut er, weil er nicht mehr universal an der Herstellung beteiligt ist. Die partikulare Erscheinungsform des Massenmenschen verhindert, dass er sich einen Begriff vom Ganzen machen kann. Die Warenhaftigkeit des Seins suggeriert dem Massenmenschen, dass die Welt selbst warenhaft ist. Die Welt ist käuflich, ein Geschäft. Dies ist immerhin ein letztes Ordnungsprinzip. Gewinnmaximierung, Wachstum. Und das ist die falscheste Idee, die wir aktuell haben könnten. Sie ist auch eine dumme Idee. Es ist eine ideenlose Idee – wenn man so will. Die Frage ist allerdings, ob uns ein elitäres Anspruchsdenken zu einer neuen Idee verhilft, die uns retten kann. Aber jene große Frage muß diesen Seiten fern bleiben; sie ist allzu groß. Sie würde uns dazu zwingen, in ihrer ganzen Fülle die Theorie des menschlichen Lebens zu entrollen… Vielleicht, daß sie bald ein Schrei wird.
14. Dezember 21
Der Doppelgänger
Von FjodorDostojewski
Urfassung in deutscher Übersetzung
von Alexander Nitzberg
Erschienen 2021 im Verlag Galiani Berlin
Das Motiv des Doppelgängers gehört zu den beliebtesten Topoi der Romantik. Die Literaturen
reichen von Chamissos Peter Schlehmil (der sich durch seinen sich verselbstständigenden Schatten verdoppelt) bis zu ETA Hoffmanns Elixiere des Teufels (dort führt die
Ähnlichkeit des Mönchs Medardus mit dem Grafen Viktorin zu tragischen Verwechslungen). Einer der ersten Doppelgänger waren aber sich der Siebenkäs und Leibgeber von Jean Paul. Jean Paul lieferte im
Siebenkäs auch gleich die passende Definition dazu: „Doppeltgänger (So heißen Leute, die sich selber sehen).“ Der Psychoanalytiker Otto Rank hat schon 1914 eine brillante Studie zum Topos
der literarischen Doppelgänger vorgelegt (Der Doppelgänger, erschienen 1914 in der Zeitschrift Imago) und zeigte auf, dass sich sowohl Jean Paul als auch ETA Hoffmann in vielerlei Hinsicht
mit der Spaltung und Vervielfältigung des Ichs beschäftigt hatten.
Das Erleben der Depersonalisation ist ein typisches Symptom bei Psychosen und wird als äußerst schmerzhaft empfunden. Eher bekannt sind hier die Verdopplungen in Berühmtheiten, Menschen die sich
einbilden sie seien Jesus oder Napoleon oder schlimmer Hitler. Als ich den Roman in seiner Letzter Hand Fassung zum ersten Mal las, erlebte ich in der Psychiatrie diese Phänomene hautnah. Goljadkin
würde man heute als eine Persönlichkeit vom Cluster A Typ einteilen, sonderbar, exaltiert und paranoid. Die Handlungsambivalenz des Goljadkin kommt bereits früh zum Ausdruck. Im zweiten Hauptstück
(Seite 17) schildert uns der russischen Großmeister Dostojwski , wie Goljadkin bei Rutenspitz erst Platz nahm, dann sich darüber klar wird, dass er Platz genommen hat ohne dazu aufgefordert worden zu
sein, steht wieder auf, besinnt sich erneut und setzt sich dann, blickt dann herausfordernd, fast beleidigt den Arzt an. Dieses sonderbare Verhalten ist typisch bei Psychotikern. Fachlich spricht man
von agitiertem Verhalten. Die Ambivalenz zieht sich durch die Hauptstücke. Im vierten Hauptstück (dem zentralen Auslöser der Verdoppelung) kann man fast von einer Erstarrung sprechen, als sich
Goljadkin fast zwei Stunden zwischen Gerümpel, Plunder und Kram aufhält, ehe er sich entschließt in den Saal zu gehen um dort naturgemäß mit seinem absonderlichen Verhalten aufzufallen.
In diesem frühen Werk des russischen Großmeisters Dostojewski ist nicht bis ins Letzte gesichert, ob außer Goljadkin dem Älteren irgendwer Goljadkin den Jüngeren wahrnehmen kann, ob also die
Verdoppelung „unseres Helden“ (wie ihn der Erzähler vielfach nennt) eine Krankheit ist oder ein Mirakel.
Auch die Schriftstellerin Sylvia Plath erforscht in ihrer Diplomarbeit von 1954 mit dem Titel „The Magic Mirror: A Study of the Double in Two of Dostoevsky’s Novels“. literarische
Doppelgänger. Ihrer Ansicht nach entsteht die Verdoppelung aus den unterdrückten Eigenschaften einer Figur und kündigt mit zunehmender Macht des Doppelgängers den Tod des Protagonisten an. Unter
Berufung auf Robert Louis Stevensons The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde enthüllt Plath die treibenden Konflikte des Romans und behauptet, dass Goljadkin versucht habe,
beunruhigende Aspekte seiner Persönlichkeit zu unterdrücken, was zur Verdopplung führte. Plath kritisiert in ihrer Darstellung Sigmund Freud und Otto Rank und fordert sie auf, den Mythos deutlicher
zu beleuchten: Nachdem das Double seinem Urheber offenbart wurde, versucht der Schöpfer typischerweise, sich vor ihm zu verstecken, bevor er schließlich einen Todeswunsch entwickelt. Für Plath drückt
sich ein solcher „Wunsch nach Vergessen“ in der „Tendenz aus, sich im Schatten und in hinteren Fluren zu verstecken; es entwickelt sich zu einem starken Todeswunsch.“ Plath sieht in der Verdoppelung
ein Identitäts-Dilemma. Gibt es überhaupt einen sozialen Ort für wahre Identität? Im zweiten Hauptstück versucht Goljadkin seinem deutschen Arzt Rutenspitz diese Selbstsicht, diese Idee von Identität
zu erläutern. Aber wir wissen, dass unser Selbstbild keineswegs mit dem Fremdbild korrespondiert, das andere von uns haben. Dieses – von Paul Watzlawick als Reziprozität bezeichnete Phänomen
einer Dissonanz zwischen dem wie ich mich selbst wahrnehme und wie mich die anderen wahrnehmen, gilt es zu bewältigen. Meistens haben wir dabei keine Probleme. Doch das Erlebnis der Depersonalisation
findet auch bei dementiell veränderten Menschen statt, da diese ihr Gedächtnis verlieren und so sagte die berühmte erste Alzheimerpatientin Auguste Deter: „Ich habe mich verloren“.
Goljadkin ist im vierten Hauptstück derart erregt durch die Gesamtsituation, dass er nichts mehr hören und sehen kann (Herr Goljadkin aber konnte nichts hören, nichts sehen, konnte einfach nichts
sehen…konnte jetzt auf keinen Fall sehen / Seite 55 ganz unten). Goljadkin wirkt nicht mehr, als sei er bei Sinnen. Er hat nichts mehr im Griff und es ist da schon offensichtlich, dass er das
Steuer aus der Hand gibt und keine Kontrolle mehr hat über seine Handlungen.
Mal abgesehen davon, wie seltsam die Vorstellung von einem Ich ist, das über die von dem Ich selbst ausgeführten Handlungen überhaupt Kontrolle hat? Wie ein Puppenspieler? Dieses Kuriosum hat schon
Heinrich von Kleist in seinem Essay Über das Marionettentheater verhandelt. Kleist stellt die Frage, welchen Einfluss Reflexion und (Selbst-)Bewusstheit auf die natürliche Anmut haben. Und
Goljadkin ist permanent im reflektierenden Selbstgespräch, stellt seine Handlungen ständig paranoid in Frage, zweifelt, handelt dann unter diesem reflektiven Einfluss unentschlossen, wirkt dabei
komisch, absurd und sonderbar.
Die Krise des Titularrates Goljadkin endet logischerweise wieder bei dem Staatsrat und hängt
ursächlich mit Klara Olsufjewna zusammen. War Goljadkin in sie verliebt? War er deshalb ohne eingeladen worden zu sein bei ihrem Geburtstag. Es wird nie erwähnt. Obwohl uns der Erzähler sehr viele
Einblicke in den Kopf seines Helden ermöglicht. Dieses wird verheimlicht, nicht zugelassen. Und vor allem ist interessant, dass gerade das entscheidende vierte Hauptstück sehr aus der
Erzählerperspektive dargestellt wird. Der Erzähler übt sich in der Kunst der Bescheidenheit, übertreibt den Topos der Bescheidenheit und erzählt uns höchst poetisch über wie wenig Poesie er als
Erzähler verfügt. Die Hälfte des vierten Hauptstückes ist im Konjunktiv gehalten: wie könnte ich diese besondere, hochanständige Mischen beschreiben… (Seite 50).
Zum Ende holt ihn der deutsche Doktor Rutenspitz ab und auf der Fahrt ins Nichts hat dieser auf einmal rote Augen und ist nicht mehr der originale Doktor Rutenspitz. Oder doch?
Lässt er nun seine „Larve“ fallen? Oder anders gefragt: Tragen wir nicht alle Masken und fürchten uns davor, dass sie uns vom Gesicht gerissen werden, dass man uns erkennt? Und sehnen wir uns nicht
gleichzeitig (während wir und davor fürchten) auch wieder danach, erkannt zu werden, so wie wir wirklich sind? Und weiter gefragt – und das ist wohl auch die Kernfrage des großen Moralisten
Dostojewski – hängt nicht alle unsere Moral davon ab, ob wir uns erkennen, wahrhaftig sind und ohne Falsch? Aber!? Wer – in Gottes Namen – bin ich? Oder – um einen Buchtitel von Richard David Precht
zu zitieren: Wer bin ich und wenn ja, wie viele?
23. November 2021
Die Glasglocke
Von Sylvia Plath
Erstmals erschienen im Jahr 1963
in der Neuübersetzung von Reinhard Kaiser 1997 im Suhrkamp Verlag
Der Roman, der im Januar 1963 bei Faber & Faber erschien, wurde in den Folgejahren zu
einer Art Kultbuch für die Frauenbewegung der 1970er Jahre. Kaum vier Wochen nach Erscheinen des Romans wählte Plath am 11. Februar 1963 den Freitod. Zuvor hatte sie ihr Mann und Vater ihrer
beiden Kinder (1 Jahr und 3 Jahre alt) Ted Hughes wegen einer Affäre mit Assia Wevill verlassen. Sechs Jahre später nahm sich auch Assia Wevill das Leben und tötete auch ihre Tochter, die sie mit Ted
Hughes hatte. Im Jahr 2009 wählte Sylvias Sohn Nicolas ebenfalls den Freitod. Die Psychologen Stirman und Pennebaker haben 2001 die Gedichte von Sylvia Plath und anderen Lyrikern
untersucht, die Selbstmord begingen. Die Analyse ergab, dass die Autoren, die später Selbstmord begingen, in ihren Gedichten deutlich häufiger Pronomina der 1. Person Singular, also "ich", "mich",
"mein" benutzten als Pronomina der 1. Person Plural wie "wir", "uns", "unser". Letztere Pronomina wurden öfter von den Dichtern verwendet, die später keinen Suizid begingen. Die durch Selbstmord
umgekommenen Dichter gebrauchten auch seltener Verben, deren Bedeutungsinhalt "Kommunikation" oder "Dialog" war wie etwa "reden", "teilen" oder "zuhören". Dafür gebrauchten sie umso häufiger Wörter,
die um das Bedeutungsfeld "Tod" kreisten. "Suizid-gefährdete Autoren sind weniger an andere gebunden und mehr mit sich selbst beschäftigt", fasste Stirman die Ergebnisse zusammen.
Lange Zeit war ich mir nicht im Klaren darüber, ob die Autoren dieser Studie mich zum Narren halten wollen, oder etwas Tiefgründiges erkannt hatten, das mir nicht zugänglich war. Vor fünf Jahren
schrieb die holländische Autorin Connie Palmen einen Roman über Sylvia Plath aus der Sicht von Ted Hughes (den die Feministin Robin Morgan in einem Gedicht einmal als „Mörder“ bezeichnet hat). Connie
Palmen wollte das Bild über den Mann gerade rücken, der jahrzehntelang für den Tod von Sylvia Plath verantwortlich gemacht wurde. Dabei hat Sylvia Plath es bereits selbst getan. Im vorliegenden Roman
heißt es an einer Stelle: „Niemand hat es getan. Sie hat es getan!“ Es ist die zornige Stimme der Psychiaterin Mrs. Nolan, die das über den Freitod von Joan sagt. Daher gibt es auch keine versteckten
Worthinweise in den Texten der Selbstmörder, die man vorher hätte entdecken können um rechtzeitig zu intervenieren. Dann wären ja die Lektoren schuld am Tod der Schriftsteller?
Um Plath gestaltete sich ein Mythos, den auch Ted Hughes selbst mit baute, weil er die Rechte am Roman besaß (sie waren noch nicht geschieden) und ordentlich durch den Verkauf verdiente.
1982, zwanzig Jahre nach dem Freitod von Sylvia Plath, wurde die Autorin posthum mit dem Pulitzerpreis für ihre Lyrik ausgezeichnet. Man fand im Nachlass bei ihr eine Collage (Plath versuchte sich
auch in der bildenden Kunst – denn sie war vorzüglich Lyrikerin), mit dem lächelnden Präsident Eisenhower im Vordergrund, dahinter Vizepräsident Nixon und in der linken oberen Ecke zwei
eigentlich viel zu alte Männer, die wie Teenager mit ferngesteuerten Autos spielen: Winzige Rennwagen brettern die Schlaufen einer Spielzeugstraße hinunter, sie rasen direkt in den Schweif eines
Flugzeugbombers, den Eisenhower, als wäre es ein Hut, auf dem Kopf trägt. Die Hände hinter dem Kopf verschränkt, die Augen geschlossen, lehnt eine Frau im Badeanzug in diese Szene hinein, womit
schließlich alles beisammen wäre, was die 1950er Jahre medial auszeichnet: Männer in Anzügen, Frauen in Badebekleidung, Kalter Krieg, Aufrüstung, Pop-Art, Werbung, Warenkultur. Nicht zu
vergessen Raumfahrt und Tablettensucht - vertreten durch Satellit und Pillenröhrchen auf Eisenhowers Schreibtisch. Es sind diese 1950er Jahre, die Sylvia Plath in dem Roman aufgezeichnet hat und ich
hatte beim Wiederlesen zum Teil die typischen nordamerikanischen Spielfilme vor Augen und hatte fast Mühe, Buddy Willard nicht für den jungen, unbeholfenen und schlaksigen James Stewart zu
halten.
Plath zelebriert den Horror dieser Zeit, den Muff, dieses Readers Digest Amerika (der Keuschheit eine Lanze) und oft konnte ich nur den Kopf schütteln über diese Kleingeister, die alle zusammen ein
junges, ehrgeiziges und verträumtes Mädchen umbrachten. Es war eine kollektive Anstrengung und die Zeit selbst, die Sylvia Plath letztlich in ihren ersten Suizidversuch trieb, den sie zehn Jahre vor
diesem Roman erlebte und darin dann auch hoch dramatisch schildert. Die Glasglocke war eine gluckenhafte Schutzglocke über das ganze Land gestülpt, das sich von Krieg und Wirtschaftskrise durch
Selbsttäuschung in Form von Massenwerbung erholte.
Aber auch das ist von mir nur Rhetorik. Denn zwischen einer historischen Epoche und einem privaten Schicksal gibt es immer noch eine Differenz.
Plath schildert diesen Sommer in New York und anschließend die Irrenhaus-Odyssee in Boston mit starken und ausdrucksstarken Bildern. Schon der Anfang lässt einen schaudern. Dem Ehepaar Rosenberg
droht der elektrische Stuhl und was Elektrizität für den menschlichen Körper bedeutet, wusste Sylvia Plath. Sie schildert später ihre Erlebnisse bei einer EKT ohne Vorsedierung. Was Mr. Gordon auf
brutale Weise falsch machte, revidierte Mrs. Norton dann. Dennoch waren diese Behandlungen damals extrem ungenau und die Dosis viel zu hoch. Heute wird die EKT punktgenau und mit winzigen Stromstößen
durchgeführt. Und es ist nach wie vor eine Ultima Ratio Therapie. Die Insulintherapie, der sich Plath ebenfalls noch unterziehen musste, ist inzwischen auch Medizingeschichte. Deep insulin coma
Therapy, kurz DICT wurde es genannt. Durch Gabe von Insulin wurde der Patient einige Minuten in den hypoglykämischen Schock gebracht, war ohnmächtig, krampfte oft auch. Dann gab man Glucagon und
beendete den Zustand. Die Folgen waren nicht selten irreversible Hirnschäden. Auch der schizophrene Mathematiker John Nash wurde auf diese Weise behandelt.
Die kurze Episode in New York, die in den ersten zehn Kapiteln geschildert werden, hat ebenfalls einen realen Hintergrund. Plath gewann durch die Erzählung „Sonntags bei Mintons“ dieses
Redaktionspraktikum und das Frauenbild, das in dieser Mode-Zeitschrift Mademoiselle (ging 2001 in Glamour auf) dargestellt wurde, hatte Plath schon in dieser Kurzgeschichte von 1952
ironisiert. Dort lebt Elizabeth bei ihrem pensionierten Bruder Henry und kocht für ihn, aber leider träumt sie zu oft vor sich hin und so verbrennt sie das Essen.
Beispielhaft erscheint Buddys Mutter Mrs. Willard als das Ideal der Frau in den 1950ern, so dass auch Joan genau so werden will. Strickend und voll mit Readers Digest Weisheiten ein Mutterfels in der
Familienbrandung. Joan bringt sich im Roman um, weil schon die Vorstellung einen wahnsinnig machen kann. Es ist diese Grausamkeit, wenn aus der Profitgier der Massenwerbung sozialgesellschaftliche
Erwartungen evoziert werden. Und bitte! Wer scheitert nicht an dem Ideal der Rama-Familie? Das ursprüngliche Arkadien, die heile Welt. Heute erleben wir dieses Idyll (eidyllion bedeutet kleines
Bildchen, auch kleines Gedicht) in Form der Rückkehr des Landlebens. Heimat ist ein Ort nach dem wir uns alle sehnen und an dem noch nie jemand war, schrieb einst Ernst Bloch. Wir werden weiter
Rama-Familien produzieren für das Fernsehen, für die Unterhaltungsindustrie, für den Markt zur Profitmaximierung. Wir werden uns weiter sehnen, kaufen und träumen. Die Lyrikerin Ingeborg Bachmann
nennt das in einem berühmten Gedicht (Reklame) „Traumwäscherei“. Der Traum, unsere Gegenwelt, wird durch die Massenwerbung rein und sauber gewaschen. Und dieses Bild bekämpfte Sylvia Plath,
wenn sie sich ihr Haar „drei Wochen nicht gewaschen“ hatte (Seite 139) und den Trauernden Gelehrtenbaum zu ihrem Lieblingsbaum erklärte. Sie meinte den japanischen Schnurbaum (den man auch als
weinenden chinesischen Gelehrtenbaum bezeichnete).
01. November 2021
Don Juan (erzählt von ihm selbst)
Von Peter Handke
Erschienen 2006 im Verlag Suhrkamp
Der Ich-Erzähler dieses Romans lebt schon lange Jahre zurückgezogen in einem ehemaligen
Gasthof in der Nähe des verfallenen Frauenklosters Port-Royal-des-Champs unweit von Versailles. Das Haus ist umgeben von einem großen, verwilderten Garten und einer hohen Mauer, welche die nötige
Stille und den hinreichenden Schutz gewähren, um ungestört erzählen zu können. Don Juan ist die mythische Gestalt des Verführers von Sevilla – so der Titel des spanischen Originals aus dem Jahr 1630
von Tirso de Molina, der neben Lope de Vega und Pedro Calderón de la Barca zu den größten Dramatikern Spaniens zählte. Bekannter ist uns die Komödie Don Juan von dem französischen
Dichter Jean Paptiste Molière, das nur 30 Jahre später 1660 erschien und sich gar nicht an die Vorlage des spanischen Autors hält. Auf dieser Komödie von Molière ruht dann die im deutschen Sprachraum
von Wanderschauspielern gezeigte Don Juan-Fassung des Italieners Lorenzo Da Ponte. Diese wurde wiederum zum Textbuch für das Libretto von Mozarts Oper vom Wüstling Don Giovanni aus dem
Jahr 1787. Zahlreiche Autoren haben sich an dem Stoff des Frauenverführers und Sinnbild der Wollust versucht. Don Juan war kein Verführer. Er hatte noch nie eine Frau verführt. So erfahren
wir es in Handkes Don Juan. Da er uns das aber „selbst erzählt“ (wie der Hinweis zum Titel in der Klammer uns sagt), sollten wir skeptisch sein, ob Don Juan hier aufrichtig ist. Zumal der
Anfang des schmalen Romans (der Novelle?) den Erzählstrom auf zweifache Weise bricht. Erlebnisse werden als Erinnerungen in der dritten Person präsentiert, die wiederum den Leser indirekt als
Schilderungen aus dem Gedächtnis des Erzählers erreichen. Die Grenze zwischen Wahrheit und Dichtung verschwimmt. Don Juan war schon immer auf der Suche nach einem Zuhörer gewesen…Seine
Geschichte erzählte er mir nicht in der Ich-Form, sondern in der dritten Person. So kommt sie mir jetzt jedenfalls in den Sinn.
Dieser wunderschöne, wirklich poetische Roman ging etwas unter in der Rezeption, da Handke in dieser Zeit ziemlich in Ungnade gefallen war. Er hatte 2004 den serbischen Kriegsverbrecher Slobodan
Milosevic im Gefängnis besucht, in einem Buch das UN-Tribunal als falsch und immer falsch gewesen bezeichnet und 2006 eine Grabrede bei der Beerdigung des Kriegsverbrechers gehalten. Milosevic
entging einer offiziellen Verurteilung des Tribunals nur durch seinen vorzeitigen Tod. Problematisch an Handkes Haltung ist zusätzlich, dass auch der Rechtspopulist und Compact-Autor Jürgen Elsässer
sich für die Unschuld von Milosevic aussprach. Nun ist Handke alles andere als ein Rechtspopulist und seine politischen Motive waren ganz andere, mehr persönlicher Natur.
Und der vorliegende Roman hat mit all diesen Dingen ohnehin nichts zu schaffen.
Dennoch gibt es einen wesentlichen Aspekt und ein wesentliches Erzählmotiv, das ist die
Einsamkeit. So lebt der Erzähler vereinsamt in einer Klosterruine, er bekommt lediglich vom Priester hin und wieder Besuch. Daher ist das Erscheinen von Don Juan (der sich da auf der Flucht befindet,
weil er einem Liebespaar beim Vereinigen nicht nur zusah, sondern danach aufstöhnte) sehr froh. Don Juan berichtet von seinen Frauen als von einsamen Frauen, die sich ihrer Einsamkeit erst durch ihn
bewusst werden. Und vermutlich war es auch um Peter Handke einsam geworden, als er sich durch seine politische Haltung zur Persona non grata machte. Don Juan ist eine gute Wahl, zumal der Verführer
und Wüstling eine geschmähte Figur ist. Während Faust die Todsünde der Neugier, der Wissbegier beging, verfiel Don Juan der Wollust. Das göttliche Strafgericht stand im Zentrum des Urtextes. Don Juan
war ein Flüchtiger und musste sich häufig Duellen stellen. Doch Handkes Don Juan ist ein anderer…. Das waren allesamt die falschen Don Juans – auch der von Molière; auch der von Mozart. …Ich sah
ihn als einen, der treu war – die Treue in Person.
Für sieben Tage bleibt Don Juan bei Handkes Erzähler, der dabei sichtlich wieder auflebt, seinen Gast bewirtet, bekocht. Währenddessen erzählt ihm Don Juan die Ereignisse der vorangegangenen Woche,
seinen Frauen auf seinen Reisen durch den Kaukasus, nach Damaskus, über Marokko und dann ist er in Holland und schließlich in Frankreich dort an dem Frauenkloster. Währenddessen wird das Kloster von
Frauen belagert.
Don Juan ist ein Erretter der Frauen. Es sind zwar wunderschöne Frauen, aber sie sind in Trauer, einsam, beschädigt. Sie gleichen den Katzen, die dem Frauenhelden in Port Royal um die Füße streichen.
Sie fliegen ihm nicht nur sprichwörtlich zu. Don Juan weiß nicht, wie er es macht. Es muss an seinen Augen, an seinem Blick liegen. Die Kontakte sind immer unauffällig oder besser nicht auffällig für
andere, so auch die Abschiede. Begleitet wird Don Juan von seinem Diener, der sich für die entstellten Frauen interessiert und sich mit ihnen vereinigt. Au dem aller größten Verbrecher
[…] einen Rasenden, einen tollen Hund, einen Teufel, einen Ketzer,[…] ein Schwein von Epikureer,[…] “ (Molière) wird bei Handke eher ein mit Frauen sprechender Franziskus. Im
Original täuscht Don Juan die Frauen, indem er in der Maske ihrer Verlobten erscheint. Handkes Don Juan täuscht nichts vor.
Da Handkes Don Juan eigentlich kein Verführer ist, eher ein von den Frauen Gejagter, der aber
auch nicht verführt wird (so erzählt er es zumindest selbst), hat Handkes Don Juan eher eine Ähnlichkeit mit Eros, diesem merkwürdigen Gott der Liebe, der halb Kind, halb Greis eine Frucht der
Vereinigung von Reichtum und Armut ist. Davon erzählt uns ja das Gastmahl von Platon. Handkes Kulisse erinnert an ein verwittertes und verwaistes Symposion, nicht am Südhang der Akropolis, sondern in
einem Garten mit Blick auf eine Ruine. Das ist ein Verweis Handkes auf die Statue des Komturs. Als Don Juan seine Geschicklichkeit verliert und mit gesenktem Kopf durch den Friedhof geht, dabei ein
asiatisches Liebespaar zur Seite rempelt, sogar auseinander sprengt, als Don Juan einen Walkman von seinem Gastgeber fordert, da dachte ich schon, dass jetzt bei dieser kippenden Stimmung auch über
Handkes Don Juan das göttliche Strafgericht sein Urteil fällt. Doch es geht anders aus. Don Juan ist ein Gast und er bleibt es bis zum Schluss. Sein wörtlich steifer Diener (ob Handke diese
versteckte Zote klar war?) besorgt die Abreise des Verführers, der in diesem Fall weder Verführer noch Verführter war. Er war ein Anderer.
Die Einsamkeit und die Sehnsucht nach Nachbarschaft, das Ich und das Du. Und dazwischen steht immer auch Eros als Wüstling oder Lehrer. Es ist eine Frage der Interpretation oder der Gesinnung. Es
gibt hier keinen festen moralischen Kompass. Anziehung und Abstoßung. Wie es im Text heißt: Etwas anderes atmete an ihrer beider Stelle… Als die Zeit der Zwei dann um war…wandten sich im
selben Augenblick voneinander ab, mit genau spiegelgleichen Bewegungen und Schritten. Eine Verkettung [der Umstände?] -
26. Oktober 21
Der Himmel vor hundert Jahren
Von Yulia Marfutova
Erschienen 2021 im Verlag Rowohlt
Die Autorin: Jung, russisch, studierte in Berlin, lebt in Boston, schreibt von einem Dorf, das vor hundert Jahren an einem Fluss gelegen ist und von der Realität der Revolution eingeholt wird. Vielfach wurde der Roman in der Presse gelobt, die Erzählstimme der Autorin als originell gewertet und sogar ein Vergleich mit der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts gezogen: Yulia Marfutova, die 1988 in Moskau geboren wurde und heute in Boston lebt, stellt ihrem auf Deutsch geschriebenen Romanerstling eine Widmung an die Großeltern voran. Das ist ein Hinweis darauf, dass das Buch als eine Familiensaga gelesen werden kann. Tatsächlich bringt Marfutova in die deutschsprachige Literatur einen Ton ein, der an die russische Literatur des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts erinnert. So beschreibt es Helmut Sturm auf Literaturkritik.de. Liest man den Roman jedoch ohne das Bedürfnis, eine Ware verkaufen zu wollen, fällt das Urteil etwas nüchterner aus. Meike Fessmann vom Tagesspiegel schreibt:
Denn das ist ja die große Frage: Wie sickert Geschichte in ein Gemeinwesen, in dem die Menschen Analphabeten sind und die „Elektrifizierung“ der Bolschewiki noch in weiter Ferne ist? „Der Himmel vor hundert Jahren“ macht aus dieser Versuchsanordnung ein beseeltes Universum von klarer Sinnlichkeit.
Nein. Weder sinnlich noch klar. Die reduzierte Sprache funktioniert nicht wirklich, auch nicht
in der Realität. Und es ist auch kein „Tableau poetischer Reduktion“. Metaphern aus der Textbausteinküche des Feuilleton-Betriebs und große Vergleiche - hier mit Orlando Figes
Geschichte Russlands - werden von der Rezensentin des Tagesspiegels aufgefahren. Aber im Text von Marfutova steht weder etwas über die Geschicke Russlands noch etwas darüber, wie man die Zeit
verorten kann. Der Text ist völlig ahistorisch und begriffsarm. Die reduzierte Sprache evoziert nur Langeweile beim Lesen und kein Wohlgefallen. Die verwendete Kunstsprache wirkt exaltiert und
aufgesetzt und nicht sehr natürlich. Zusätzlich ist völlig unklar wer der Erzähler überhaupt ist, wer uns die Geschichte erzählt. Einmal heißt es „Die Kirche, sagt das Dorf, ist ja die Kirche.“ Damit
ist klar, dass es einen heterodiegetischen Erzähler außerhalb des Dorfes gibt. Der weiß aber wohl auch nicht viel mehr, als Piotr oder Anna. Es ist klar, dass es die Autorin selbst ist, die den Roman
eingangs ihren Großeltern widmete und überhaupt nicht klar, ob die sich darüber so freuten. Die Figuren sind nicht sichtbar. Am besten kann man noch Wadik wahrnehmen, der als einziger wirklich etwas
macht, nämlich schnitzen und nicht reden (was ein aktives nicht reden ist). Anna ist schon nicht mehr greifbar, der Gegensatz von Piotr und Ilja ist ganz nett aber die redundante Wiederholung des
Röhrchens und der Flußgeister ist nicht sinnlich. Vielmehr ist der Text von großer Bildarmut geprägt und leidet unter der Sprachreduktion. Der Text wirkt seltsam abstrakt und ästhetisch irgendwie
abgehoben. Der Versuch unbedingt originell zu sein ist dem Text anzusehen. So wirkt das unfreiwillig albern und die Jugend hat dafür das Jugendwort des Jahres geprägt, der Text ist cringe.
Nach dem Leseflopp mit Hopp(e) und ihren Kaffeeklatsch-Nibelungen, jetzt ein Text über ein aus potemkinschen Requisiten halbherzig zusammengeschustertes Historiendörflein. Auf ein Wirrwarr an
Meinungen und Gegenmeinungen zu Gegenmeinungen, läuft es mangels Inhalt nicht hinaus, nichts zu machen, nein, es schweift hier auch nichts hin und her und wieder
zurück. Laurence Sterne und Salman Rushdie liebten das gesprochene und geschriebene Wort nicht nur, sie konnten auch damit umgehen und hatten noch ernsthafte Mediengegner. Hier hat man den
Eindruck, dass die meisten Rezensenten irgendwelche Halluzinogene geraucht haben und in der Folge sind ihre Besprechungen dann kreativer und sprachgewandter, als die von ihnen in ihren kreativen und
sprachgewandten Texten gelobten Texte. Daher empfahl Steve Jobs allen Mitarbeitern seiner Firma, erst mal einen Trip einzuwerfen. Hört, hört.
Die Autorin: Jung, russisch, studierte in Berlin, lebt in Boston, schreibt von einem Dorf, das vor hundert Jahren an einem Fluss gelegen ist und von der Realität der Revolution eingeholt wird.
Um das klar zu stellen. Wiederholungen sind nicht immer und automatisch ein Stilmittel des stream of consciousness. Wiederholungen sind manchmal einfach nur Wiederholungen. Und dieser Text
strotzt von solchen „einfach nur Wiederholungen“.
Es ist zum Verzweifeln, denkt sich so mancher im Dorf, wenn auch lange nicht jeder heißt es am Beginn des 13. Kapitels. Was bemerkt wurde, was manche mitbekommen haben, andere nicht und was das mit der Weißheit von Iljas Bart zu tun hat? Das ist nur ein öder Sprachwitz, das ist schon wieder cringe.
Ein wenig geht es mir wie Ilja. „Mhm.“
Der Zar, ach. Das wäre ein eigenes Thema, seufzt Wadik. Der Zar ist ein Thema für sich. Aber das seufzt er erst später. Ja. Das ist wirklich zum Seufzen.
Großvater: Mhm.
Großmutter: [weitere Ausrufe, ggf.Flüche]!
Großvater: Mhm.
Großmutter: [lautere Ausrufe, definitiv Flüche]!
Aber zurück zur Realität, oder sagen wir, was?
Genau. Fragen über Fragen habe ich nicht zu diesem Text. Auch nicht in der Zukunft. Da ich nur vom Titel weiß, dass das vor hundert Jahren war, was allerdings in hundert Jahren auch der Fall sein wird. Aber das macht den Text noch lange nicht zeitlos. Es ist vielleicht ein allgemeines Missverständnis zwischen Buchproduzenten und Konsumenten, dass was exotisch aussieht auch exotisch schmeckt. Der Geschmack müsste da schon degeneriert sein und die Zunge sich von den Augen derart überlisten lassen, dass es schon wieder rühmlich wäre. Aber auch das tut es nicht. Die Autorin: Jung, russisch, studierte in Berlin, lebt in Boston, schreibt von einem Dorf, das vor hundert Jahren an einem Fluss gelegen ist und von der Realität der Revolution eingeholt wird. Das reicht nicht zur Augentäuschung. Eher könnte man das βαρύς in Barometer wörtlich nehmen. Der Maßstab wurde schwer gedrückt. Und Evangelista Torricelli lebte vor 500 Jahren, nicht vor hundert. Allein das ist schon purer Unfug, ja fast eine Form der Unverschämtheit. Eine Metapher für einen ganzen Roman die so gar nicht funktioniert, funktionieren kann, weil sie völlig falsch ist, anzuwenden? Und in keiner einzigen Rezension kam das zur Sprache! Es ist kein Wunder, dass viele Menschen glauben, die Klimaerwärmung sei pure Absicht, weil ein Großteil der Politiker in Wahrheit Reptiloide sind (das glauben in den USA über 20 Prozent der Menschen – siehe Insidejob von Shion Takeuchi). Und Philip K. Dick glaubte, wir alle lebten noch zurzeit von Christi Geburt, alles andere sei eine Illusion des Teufels. Soweit würde ich nicht gehen. Aber im letzten Jahr waren wir alle noch „lost“ und daher….!?
20. Oktober 2021
Die Nibelungen
– Ein deutscher Stummfilm
Von Felicitas Hoppe
Erschienen 2021 im Verlag S. Fischer
Mein Vater hatte sich im Nachkriegsdeutschland den Namen „Hagen“ zugelegt, denn „Horwatitsch“
klang den meisten zu fremdländisch. Ich weiß noch, dass sich mein Vater immer so vorstellte: Mein Name ist Hagen, wie der Siegfriedmörder. Mir blieb das im Gedächtnis, da ich selbst lange Zeit als
Bernhard Hagen bekannt war, ehe mir mein echter bürgerlicher Name zugetragen wurde. Das ist aber auch schon alles, was mich mit dem vorliegenden Stoff verbindet. Von jeher zog es mich eher zu den
alten Griechen, als zu den alten Germanen. Eine kurze Zeit versuchte ich die Edda zu lesen und Runen zu deuten. Doch diese Verwirrung endete mit einer christlichen Ehe.
Irgendwann im fünften oder sechsten nachchristlichen Jahrhundert, als die Welt noch von Burgundern und Hunnen bewohnt wurde, ereignete sich neben einer Völkerwanderung (die Hunnen und die Langobarden
wanderten herum) auch Schicksalhaftes. Und als man im achtzehnten Jahrhundert eine Handschrift des Nibelungenlieds wiederentdeckte, erklärte ausgerechnet ein Schweizer (Johann Jakob Bodmer) das
Nibelungenlied zur Deutschen Ilias. Die Büchnerpreis-Trägerin von 2012 Felicitas Hoppe griff nun diesen zuletzt von Uli Edel 2004 filmisch malträtierten Stoff auf und machte daraus einen
metareflexiven expressionistisch anmutenden Theaterslapstick. Aus dem Kunstblut Uli Edels wird Kuchensahne. Aus den mythischen Figuren werden Laiendarsteller am Wormser Freilichttheater, aus der
Deutschen Ilias wird – ja was eigentlich?
Wer meine Buch-Besprechungen kennt, weiß dass ich das nie mache. Schon das Klangbild des
Wortes Kritik erscheint mir unschön, was wohl an den beiden Schnalzkonsonanten liegt. Doch wenn eine Autorin sich für witzig, originell und klug hält, ohne diese Versprechen wirklich
einzulösen, dann evoziert dies beim Rezipientin das sehr unangenehme Gefühl des Fremdschämens.
Nun ist es zunächst eine wirklich gute Idee, dem Nibelungen-Stoff in ironischer Manier zu begegnen. Doch der Titel „Ein deutscher Stummfilm“ wird nicht eingehalten, Fritz Lang ist am Ende nur ein
Köder für die Leser. Kettelhof hin und Kettelhof her. Die Reiterin (Felicitas Quatsch Hoppe Hoppe Reiter) parodiert ein Theaterstück und hat sich wohl beim Freilufttheater am Wormser Dom eine
Erkältung zugezogen, die sie uns im Nachspann verschweigt. Denn nicht Quentin Tarantino führte in dem Text die Regie, sondern eine der deutschen Autorenregie treue Kaffeeklatsch-Tante. Hoppes
Siegfried erinnert aber auch an den ehemaligen Hammerwerfer und Gelegenheitsschauspieler Uwe Beyer, der in Harald Reinls Film von 1967 die Rolle des Siegfried spielte, schlecht spielte und
unfreiwillig komisch spielte.
Über die goldene Dreizehn fand ich in der Recherche lediglich eine Musik-Kombi aus der
Nachkriegszeit, die sich so nannten. Von dem erhofften Zitatenreichtum konnte ich wenig feststellen, weder Simrock noch Fouqué oder Hebbels, noch Wagner (da allerdings Gott sei Dank nicht auch noch
Wagner). Schon Schopenhauer warnte die deutschen Schriftsteller vor dem Stoff, denn er sei mit der ehrwürdigen Ilias nicht gleichzusetzen. Aber letztlich handelt die Ilias auch nur von alten
griechischen Männern, die ihre Emotionen nicht richtig im Griff haben.
Der anonyme Autor des Nibelungenlieds kannte sich gut aus, er zitiert aus dem Rolandslied, beherrschte die zeitgenössische Troubadourlyrik, und schöpfte aus der Heiligenlegende des Reinaldus (Reinald
von Montalban / Stadtpatron von Dortmund). Eine lichte Waffe, aus deren Knaufe schien - Mit hellem Glanz ein Jaspis, grüner als das Gras, woraus Hoppe den grünen Jäger macht, ist ein Zitat
aus Vergils Äneas. Äneas, „trug ein Schwert, von gelblichem Jaspis blitzend bestirnt.“ Auch die Tarnkappe erinnert an den antiken Mythos der Tarnkappe des Hermes, der sie dem Drachentöter
Perseus lieh. Brünhild ist der griechischen Göttin Artemis nachgebildet, der man Männer opferte. Der unbekannte Autor der Nibelungen war ein gebildeter Mensch des MA. Der eigentliche Schatz war das
verlorene Mythenwissen des untergegangen Roms. Pech irgendwie, dass dem Autor der Nibelungen das Urheberrecht durch Namensstreichung verloren ging.
In den Rezensionen wird Frau Hoppe sehr gefeiert und der Zitatenreichtum hervorgehoben. Lustvoll jongliert Felicitas Hoppe mit Bezügen aus Literatur und Kultur, behauptet zum Beispiel Juliane Bergmann vom NDR, und Kristina Maidt-Zinke von der SZ spricht gar von unbändiger Fabulierlust. Kettelhut, gut, ist der Name von Erich Kettelhut, Bühnenbildner von Fritz Lang. Okay. Und? Sollte mir das imponieren? Im ganzen Text steckt diese bemüht wirkende intellektuelle Energie. Ein wahrhaft „verzettelter“ Sommernachtstraum (in der Version des Gryphius natürlich) gespielt von Peter Squenz.
Doch Belesenheit und Informiertheit müssen sich am Ende in Lesbares umsetzen. Gelegentlich lachte ich mit, aber meist war es ein bemühtes Lächeln, peinlich hüstelndes Lächeln über derart quellenlosen Unfug, der sich nirgends fügt. Über Tom Gerhardts Siegfried-Persiflage von 2005 konnte ich herzhaft lachen, weil es sich selbst nicht ernst nahm. Hoppe nimmt sich aber dann doch als Intellektuelle zu ernst, um einfach nur Quatsch zu machen. Daher ist der Roman nicht Fisch und nicht Fleisch. Irgendwo zwischen Albernheit und kultureller Beflissenheit wackelt die Story noch mehr, als die Vorlage selbst, die ja aus 39 Adventuren besteht, während Hoppe hier deutlich überzieht (auf 47 Kapitelüberschriften).
Als ich mit dem Roman fertig war, hatte ich mehr Arbeit vor mir, als zuvor. Meine Ratlosigkeit mit dem die expressionistische Sprache imitierenden Text verstärkte sich durch die vielen positiven Rezensionen noch mehr. Was stimmt nicht mit mir? Es wäre interessant diesen Text ins Schwedische, Norwegische zu übertragen, wo die Völsunga- oder die Thidreks-Saga noch lebendiger sind als in Deutschland. Denn trotz all der Nibelungenstädte und trotz der reichhaltigen Rezeption des Stoffes und trotz Bayreuth, haben es Siegfried, Kriemhild, Brunhild, Gunther, Gernot, Giselher (die drei G – ganz ohne Impfung), sehr schwer. Ein deutsches nationales Epos kann es seit „Mein Kampf“ nicht mehr geben. Der Untergang des tausendjährigen Reiches ähnelt auf absurd-fatale Weise dem Finale der Nibelungen. Mein Name ist Hagen, wie der Siegfried-Mörder, war die äußerste Selbstironie meines Vaters, der diesen Namen von seinem Vater übernommen hatte, der als Schauspieler und späterer Intendant in Ulm tätig war und „Hagen“ als Künstlernamen trug.
Ein kultureller Clash zwischen Rhein und Donau. Doch die Konturen des Nation-Building der deutschen Nation taucht im Roman von Hoppe auch nicht auf. Unter den bemühten Albernheit des Zwerg Zorn, (albern von Alberich), und den anstrengenden Gewaltvermeidungstaktiken der Erzählerin (wer auch immer das sein mag, denn auch das ist in dem Text verwirrend, dass man nie wirklich weiß, wer hier was erzählt) lässt sich kaum erkennen, dass auch die Nibelungen nur ein Remake ist.
28. 09. 2021
Narrenleben
Von Hans Joachim Schädlich
Erschienen 2016 als TB
im Verlag Rowohlt
In diesem quellenreichen halbdokumentarischen Roman beschreibt der Vogtländer Hans Joachim
Schädlich das Leben des gelernten Müllers Joseph Fröhlich, der aus der Steiermark stammte und bei August dem Starken, dem Kurfürsten von Sachsen und König von Polen zum Hofnarren avancierte. Im
zweiten Teil des Romans wird das Leben des Tiroler Handschuhmachers Peter Prosch geschildert, der ebenfalls als Hofnarr herhalten musste. Letzterer allerdings unfreiwillig. Beide Leben verschränkt
Schädlich dadurch, dass Peter Prosch einen Brief an Joseph Fröhlich schreibt. Dieser kommt allerdings siebzehn Jahre zu spät, denn Joseph Fröhlich starb im Jahr 1757 im Alter von 63 Jahren. Da war
Peter Prosch gerade mal 13 Jahre alt und lernte erstmals die Kaiserin Marie Theresia kennen.
Sowohl Fröhlich als auch Prosch haben schriftliche Werke hinterlassen an denen Schädlich sich auch reichlich bedient. Zusätzliche Quellen und Zitate stammen von Ulrich Bäker, einem Schweizer
Schriftsteller, der eine Autobiografie über sein Leben schrieb in dessen Zentrum das Elend eines Söldners im Siebenjährigen Krieg steht. Dieser Siebenjährige Krieg von 1756 bis 1763 gilt einigen
Historikern als erster Weltkrieg, da er sich auch in den Kolonien Afrikas und Amerikas abspielte. Er war aber rein technisch der letzte Kabinettskrieg mit vergleichsweise (also im Vergleich zu den
beiden Weltkriegen im 20. Jahrhundert) noch geringem Personal- und Sachschäden. Dennoch ist er grausam genug und zwang den Hofnarren Joseph Fröhlich, seine zweite Ehefrau in Dresden
zurückzulassen und nach Warschau zu gehen, wo er dann verstarb.
August der Starke war ein Kurfürst, der seinen Beinamen sicher auf der Grundlage seiner Potenz erhielt. Schädlich versteht es meisterhaft, die Verwicklungen zu erzählen, die der Hofstaat und die
Mätressen des Kurfürsten betreffen.
Schädlich beginnt seinen Roman noch mitten im Hochbarock. Er schildert zum Beispiel ausführlich das Zeithainer Lustlager, ein Fest das nördlich von Dresden über einen Monat dauerte und von
extrovertierter barocker Übertreibungskunst nur strotzt. Ein Stollen von neun Metern Länge und eineinhalb Metern Höhe, der mit acht Pferden herbeigebracht werden musste, wurde zur Legende, die bis
heute am Dresdner Strietzelmarkt gefeiert wird. Ein abschließendes Feuerwerk (was zu den üblichen Spektakel der barocken Hoffeste gehörte) in Riesa „wobei Menschenleben so wenig als Geld
geschont ward“ (Bayrische Landbötin), Kostenfaktor fünf Millionen Taler. Das wären heute umgerechnet etwa 100 Millionen Euro.
Das Fest war eine Machtdemonstration des Kurfürsten mit entsprechender Truppenschau, kurz nach dem militärischen Erfolg in den nordischen Kriegen, wo man mit Russland und Dänemark die Schweden
kleinhackte. Mit anwesend beim Zeithainer Lustlager war der Soldatenkönig der Preußen Friedrich I. Doch der verdient den Beinamen keineswegs. Friedrich Wilhelm I von Preußen war ein ekliger Tyrann,
der gegen nahezu jede in seiner Zeit herrschende Etikette verstieß. Schon als Kind litt er unter unbeherrschbaren Wutausbrüchen und warf seine Spielkameraden direkt aus dem Fenster. Er lernte nie,
seine Affekte zu beherrschen und seine Zeitgenossen urteilten sehr deutlich und ablehnend über ihn. Später schlug er eigenhändig seine Untertanen, hätte beinahe seinen eigenen Sohn hinrichten lassen.
Friedrich Wilhelm I von Preußen hatte einen geldgierigen Analcharakter, badete sprichwörtlich wie Dagobert Duck in Goldthalern, Tausende verließen aus Kummer und Sorgen das Land während seiner
Regentschaft. Er ließ Massen junger, großgewachsener Männer aus ganz Europa entführen (seine „langen Kerls“), die er dann wie Puppen exerzieren ließ. Er war hochgradig misogyn, wissenschaftsfeindlich
und männerbündlerisch und litt unter regelmäßig auftretenden psychotischen Schüben in denen er noch unerträglicher und ekliger wurde. Er litt an der Erbkrankheit Porphyrie, die unter inzestuösen
Hohenzollern verbreitet war und trotz all dieser Makel haben ihn die Historiker immer sehr wohlwollend behandelt. Nur eines hat er wirklich gut gemacht: "Wir ordnen und befehlen hiermit allen
Ernstes, daß die Advocati wollene schwartze Mäntel, welche bis unter das Knie gehen, unserer Verordnung gemäß zu tragen haben, damit man diese Spitzbuben schon von weitem erkennt."‘
Bis heute tragen die Spitzbuben diese schwarzen Roben und sind bereits von Weitem zu erkennen.
Sein Sohn Friedrich II. (der Alte Fritz), war nicht wirklich besser. Immerhin war er tatsächlich bei jedem Krieg persönlich mit dabei, im Gegensatz zu seinem Vater der nur mit Zinnsoldaten spielte.
Doch dieser echte Soldatenkönig führte seine ganze Regentschaft über Krieg. Alles was die Historiker ihm inzwischen gut schreiben, tat er nur aus kriegerischem Instinkt. Die Szene als die besiegten
Sachsen ihren Soldateneid für den Preußenkönig schwören müssen, spricht Bände. Schädlich hat diesem Preußenkönig Friedrich II. einen eigenen Roman gewidmet, wo er dessen berühmte Freundschaft mit
Voltaire aufarbeitet (Sire, ich eile) und auch Voltaire geht es nicht gut, sobald er sich erdreistet, dem Willen des Mächtigen nicht zu gehorchen. Er wurde in Frankfurt inhaftiert und beraubt, alles
im Namen des Königs von Preußen.
Die Ignoranz und Menschenverachtung barocker Fürsten und Könige zeigt sich vor allem in dem
bitteren Bericht von Peter Prosch, der tatsächlich übelste Misshandlungen zum Gespött des Adels auszuhalten hatte, bis hin zur Duldung, dass man seine Ehefrau vergewaltigt.
Der Autor Hans Joachim Schädlich weiß sehr genau worüber er schreibt, konnte er doch in der alten DDR nicht veröffentlichen, weil seine Texte zu kritisch waren. Er wurde von seinem eigenen Bruder
bespitzelt. Auch darüber schrieb H. J. Schädlich (Die Sache mit B.).
Ob verschwenderischer Sachse oder kriegerischer Preuße. Sie schenkten sich nichts in der Missachtung der Menschenrechte. Auch die smarte Gemahlin Kaiserin und später Mutter Kaiserin Maria Theresia
war nichts weiter als eine von Macht und den Vorteilen der Macht angetriebene Herrscherin. Ihre vermeintlichen Wohltaten in der Bildungspolitik sind der Niederlage im Siebenjährigen Krieg geschuldet,
denn da setzte sich das preußische Bildungsmonopol durch. Aus dieser Zeit stammt noch unsere 45-Minuten-Taktung, der Frontalunterricht, die gesamte körperliche Disziplinierung, die Michel Foucault so
ausführlich in seinem Werk beschreibt.
Die lebendigen und sympathischen Gestalten Fröhlich und Schmiedel waren die Vorform der Stand-up-Comedy. Später hießen sie Loriot, Heinz Erhardt, Otto Waalkes, Michael Mittermeier, Atze
Schröder.
Peter Prosch geriet dagegen reichlich unfreiwillig in diese Branche. Aber gerade das zeigt, dass dieser Spaß immer Kosten verursacht. Der Spott (von spotzen, spucken, auf jemanden spucken) traf im
Falle von Peter Prosch den Komödianten selbst.
15. 09. 2021
Levys Testament
Von Ulrike Edschmid
Erschienen 2021 im Verlag Suhrkamp
Hotspur bedeutet so viel wie eine ungestüme, unbesonnene Person und bezieht sich auf einen
adligen Militärführer des Spätmittelalters. Das Motto des Lieblingsvereins des Engländers ist daher Audere est Facere (wagen ist Tun). 1886, nur vier Jahre nach Gründung der Lilywhites wanderte der
Urgroßvater des Engländers im Alter von fünfzehn aus Petrikau aus und kam in London an. Im Jahr 1924 steht er im Old Bailey, am zentralen Strafgerichtshof, am ehemaligen Stadttor Newgate wegen
Versicherungsbetrugs vor Gericht. Ebenso steht der Großvater des Engländers Jacob Levy vor Gericht. Dieser wird noch härter bestraft und wird das Gefängnis nicht überleben. Zudem wird er und seine
Familie durch Levys Testament ausgeschlossen. Den Engländer lernte die Erzählerin in den 1970er Jahren kennen, als an eben diesem zentralen Strafgerichtshof die Anarchisten der Angry Brigade in dem
wohl längsten Prozess dieses Gerichts verurteilt wurden.
In den Zeitungsrezensionen wird immer vornehm verschwiegen, wer der Engländer ist. Es heißt (zum Beispiel bei der FAZ oder der ZEIT) dann in den Besprechungen, man könne ihn anhand des Romans von
Ulrike Edschmid googlen. Dieses lächerliche Versteckspiel ohne Sinn und Verstand funktioniert im Roman, weil „Der Engländer“ auf diese Weise sein enigmatisches Familien-Stigma auch sprachlich
gespiegelt bekommt. Aber dieses Versteckspiel in einer Buchbesprechung weiter zu spielen, entbehrt jeder rationalen Grundlage. Der Engländer heißt Brian Michaels. Er hat einen kleinen und
überschaubaren Wikipedia-Eintrag wo nichts über seine Familiengeschichte drin steht und auch nichts über seine anarchistische Vergangenheit. Doch als Mitbegründer des ersten deutschen
Immigrantentheaters im Gallus in Frankfurt ist er immerhin eine gewisse Berühmtheit, von der ich persönlich durch Edschmids Roman zum allerersten Mal hörte. Weshalb dann diese Geheimniskrämerei in
den Feuilletons?
Edschmid verschränkt auf raffinierte Weise die Prozessgeschichte des Old Bailey mit der jüdischen Vergangenheit des Theaterregisseurs Brian Michaels. Im Grunde wird jeder berühmte, auch auf Wikipedia
erwähnte Prozess der im zentralen Strafgerichtshof Londons stattgefunden hat mal erwähnt. Von Oskar Wilde, Hawley Crippen, Emmeline Pankhurst, Ruth Ellis, die Krey-Zwillinge. Ich glaube, dass
lediglich der Yorkshire Ripper Peter Sutcliffe (er ermordete in den 1970er Jahren 13 Frauen) nicht erwähnt wurde.
Edschmid macht das elegant, führt uns von der Welt der Anarchisten zu einer Familienaufstellung. Fast könnte man es amüsant nennen, dass ein überzeugter Linker, der sich als Arbeiter sieht und Sohn eines Arbeiters, am Ende der Spross einer steinreichen jüdischen Spekulanten-Familie ist.
Wie immer liest sich Ulrike Edschmid (die Geschichtenfinderin – wie sie sich selbst gerne nennt) präzise, denn sie streicht jedes überflüssige Gramm Sprache aus dem Text heraus. Diese Reduktion hinterlässt einen Text der auf knappem Raum einen gewaltigen historischen Horizont öffnet. Neben der Prozessgeschichte des Old Bailey erzählt uns Edschmid die verwickelte Hintergrundgeschichte von Ginger Joe, den Vater des Engländers, dessen Vater von der jüdischen Familie Levy verstoßen wurde, ja gelöscht wurde. Dabei erfahren wir das jüdische Drama des Holocaust durch die Aufarbeitungsleistung von Brian Michaels. Bis hin zu dem bulgarischen Metropolit der bulgarischen Diözese Powkow, Kiril. Kiril war von 1938 bis 1969 Oberbischof der Diözese, wurde 1953 der erste Patriarch der Bulgarisch-orthodoxen Kirche. Seine Rettungstat vom März 1943, als er 600 Juden vor der Deportation und dem sicheren Tod rettete, ist nicht seine einzige. Ein Jahr später rettete er fünf Männer der Partisanenbewegung vor der Hinrichtung und erwirkte deren Freilassung. Allein diese Passage gäbe einen eigenen Roman her. Und das Ende des Romans von Ulrike Edschmid ist auch der Wahlspruch der Tottenham Hotspurs: Unser Team hat verloren, aber das Spiel war besser als ein Stück von Shakespeare. Die letzte große Niederlage des Londoner Traditionsclubs wird noch beschrieben, es war die Niederlage gegen FC Liverpool im Finale der Champions League. Dass der FC Liverpool von einem Deutschen trainiert wird, wäre als ironische Zugabe noch erwähnenswert.
Insgesamt habe ich den Roman genossen. Und doch frage ich nach dem Motiv. Sind es gar mehrere
Motive die Edschmid zu einem verschmolz? Den Satz von Ginger Joe „They did not look after me” kann man mehrfach lesen. Das Hochzeitsfoto mit dem Knick drin, der Jacob exakt abschneidet. Es sind immer
wieder diese kleinen Details die Edschmid erwähnt, die den Roman so kennzeichnet. Das machte sich schon in ihrem ersten Erfolgsroman „Das Verschwinden des Philip S.“ ähnlich. Dort geht es um eine
ähnliche Dramaturgie, denn der jüngere Bruder des berühmten Formel 1 Rennfahrers Werner Sauber radikalisierte sich, und tötete bei einem Schusswechsel einen Polizisten, und wurde selbst erschossen.
Die Familie Sauber hat mit Werner Sauber ähnliches vollzogen, wie der Patriarch Levy mit Jacob.
Auch Werner, den Ulrike Edschmid zu Philip S. nicht gerade anspruchsvoll verfremdet, war ein Liebhaber von Ulrike Edschmid. Auch in ihrem Roman „Ein Mann der fällt“ schrieb sie über einen ihrer
Liebhaber. Und in dem Roman „Die Liebhaber meiner Mutter“ spricht schon der Titel dafür, dass es sich bei Ulrike Edschmid auch um eine kunstvolle Lebensstilisierung handelt. Ulrike Edschmid ist
immerhin der Jahrgang meiner Mutter. Sie lebt in Berlin lieber in einem lauten und problematischen Viertel, als in einer ruhigen Villengegend, weil ihr das Leben dort am ehesten
begegnet.
Man muss bei dem Namen Edschmid nun nicht mehr sofort an den nationalsozialistischen
Schriftsteller Kasimir Edschmid denken, den Schwiegervater von Ulrike.
Hotspur, der Engländer findet keine Heimat, bleibt bis zum Ende rastlos. Brian Michaels lebt bereits seit 1973 in Deutschland. Laut Aussage von Ulrike Edschmid war er damit einverstanden, dass sie
über ihn schreibt, über seine prekäre Familiengeschichte.
Bedenkt man wie kompliziert jeder Familienmythos schon für sich ist, kann man sich kaum vorstellen was es mit einem Menschen macht, wenn man erfährt dass man der Spross einer totgeschwiegenen,
doppelt ausgestoßenen Linie ist. Die Juden stoßen bis heute im Antisemitismus auf Ablehnung, fühlen sich seit Generationen als Heimatlose, als Ausgestoßene. Der Engländer ist auch noch von den
Ausgestoßenen ausgestoßen worden. So konnte der Engländer trotz aller Bemühungen nicht mehr klären, wer sein Urgroßvater in Polen war. Der Zufall wollte es, dass er auf seine Tante stößt und dort das
Testament vorgelesen bekommt.
Wir halten uns heutzutage ja alle für Individuen. Dabei vergessen wir gerne unsere epigenetische Prägung und leben in einem vergessenen Knochengerüst. Familien unterliegen einer gewissen Entropie.
Familien sind halb geschlossene Systeme und geraten irgendwann in einen Zustand höchster Unordnung. Wir nennen das dann Vergessen.
27. Juli 21
Bummel durch Europa
Von Mark Twain
Aus dem Amerikanischen von Ana Maria Brock
Erschienen 1990 im Verlag Diogenes
Originaltitel der Erstausgabe
„A Tramp Abroad“
in American Publishing Company, 1880
1878, zwei Jahre, nachdem der Roman „Tom Sawyers Abenteuer“ erschienen war und dem Autor
endgültig literarischen Ruhm beschert hatte, reiste Mark Twain nach und durch Europa, allerdings, wie sich zeigte, weniger zu Fuß als per Zug, Kutsche und, einige Kilometer, per Floß. Clemens und
Twichell unternahmen bereits 1874 eine Wanderung von über 160 Meilen nach Boston. Sie wurde am zweiten Tag abgebrochen, als sie beschlossen, den Zug zu nehmen.
Nun aber wirklich zu Fuß durch Europa! Die Nord-Virginia-Armee hatte grade mal vor 13 Jahren bei Appomattox Court House, Virginia kapituliert und der Sezessionskrieg war vorbei. Die USA war in den
Nachkriegsjahren sehr damit beschäftigt die Abschaffung der Sklaverei konstitutionell zu verankern. Aber die Mason-Dixon-Linie gab es und gibt es ideologisch immer noch und bis heute ist der
Süden mit friedlichen Mitteln nur schwer dazu zu bringen, die Hautfarbe nicht als substantiellen Beleg der menschlichen Rasse zu begreifen. Mark Twain reiste wie ein amerikanischer Tourist mit seinem
Freund, dem Reverent Joseph Hopkins Twichell durch Deutschland, die Alpen und Italien. Obwohl Mark Twain über die Bewohner der Stadt Hirschhorn schrieb sie seien „missgebildete, glotzende,
ungewaschene und ungekämmte Schwachsinnige“, und den Lohengrin für „Katzenmusik“ hält, ist sein Gesamteindruck geprägt vom „Gipfel der Schönheit“. Nicht nur die Natur erscheint ihm besonders,
auch die Freundlichkeit der Deutschen erwähnt er mehrfach und empfiehlt sich auch seinen Landsleuten. Wenn er jedoch dann beschreibt, wie die Frauen den Schubkarren ziehen, anstelle eines Hundes oder
einer dürren Kuh, die Zimmermädchen mehrere Tonnen Wasser schleppen müssen in hundert Pfund schweren Metallkannen, dann stellt sich die Frage, ob in Europa (in Deutschland, im Neckar) das Geschlecht
als substantieller Beleg für die menschliche Rasse gilt. Twain zeigt die Widersprüche. „Es ist eine geistlose Stadt“, notierte er über Baden-Baden, „voll von Schein und Schwindel und mickerigem
Betrug und Aufgeblasenheit – aber die Bäder sind gut“. Die USA hatten sich von der kolonialen Knechtschaft befreit, die Sklaverei abgeschafft und wenige Jahrzehnte später übernahmen sie die
kulturelle und intellektuelle Vorherrschaft über die Welt. Mark Twain ist einer der hellsten Vorboten dieser guten Seite der USA. Was hätte er nur über Trump und dessen Gefolgschaft spotten
können!
Twains langjähriger Freund und Reisebegleiter Joseph Twichell war wie Twain ein vehementer Gegner der Sklaverei und trat ein paar Wochen nach dem Feuer der Konföderation auf Fort Sumter im April 1861 (Beginn des Bürgerkriegs) in die Unionsarmee ein. Er wurde Kaplan der 71. New York State Volunteers, eines von fünf Regimentern der Excelsior-Brigade unter dem Kommando von General Daniel E. Sickles. Das Regiment bestand größtenteils aus irischen Katholiken der Arbeiterklasse aus Lower Manhattan, und viele von ihnen waren Einwanderer. In einem Brief an seinen Vater bemerkte er:
„Wenn Sie mich fragen, warum ich an diesem Regiment, das aus groben, bösen Männern zusammengesetzt ist, festhielt, antworte ich, dass genau das der eigentliche Grund war. Ich würde das ungern wiederholen. Aber der freundliche Umgang mit einer Klasse von Männern, die wenig daran gewöhnt sind, sollte doch einen positiven Eindruck hinterlassen haben.“
Alias Harris begleitet Twichell Mark Twain nicht nur durch Europa, sondern durch ‚s Leben. Er
war über 50 Jahre lang sein Freund, sein Berater, führte Twains Hochzeit durch, taufte dessen Kinder und versorgte Twain mit seinem Anstand und seinem Humor. Mark Twain selbst erblickte als Samuel
Langhorne Clemens 1835 in Florida, Missouri das Licht der Welt. Er besuchte nur ein paar Jahre die Volksschule und begann im Alter von 11 Jahren seine Ausbildung zum Schriftsetzer. Dem Umgang mit
Gedrucktem blieb er treu. In seinen Zwanzigern war er Lotse auf einem Missipidampfer und aus dieser Zeit stammt sein Pseudonym. Mark Twain, zwei Faden tief, mark two, durch den Dialekt in mark twain
verwandelt, musste der Mississippi schon haben, damit das Dampfschiff nicht auflaufen würde.
Dieses Freundesgespann nahm sich bei dieser Reise selbst auch nicht allzu ernst und in diesem Sinn sind die Reiseberichte von satirischen Übertreibungen durchzogen.
Eingestreut sind immer wieder deutsche Sagen, die Twain herrlich nacherzählt, aber auch wunderbare Fabeln und Tierbeobachtungen. Herausragend war seine Schilderung der Beschäftigung von Ameisen (22.
Kapitel). Und immer wieder macht sich Twain über die amerikanischen Touristen lustig (besonders im 27. Kapitel). Die besondere Vorliebe der Deutschen für die nicht enden wollenden Wagner-Opern, sein
Entsetzen über Arien, die seiner Ansicht nach eine besondere Vorbildung brauchen um zu gefallen, erweisen Twain als jemanden der mit seiner Bildungsferne ironisch spielt.
Im Anhang gibt es das berühmte Essay mit Twains Vorschlägen zur Verbesserung der deutschen
Sprache, wo er sich über die ziemlich verwirrende Vielfalt der Artikel lustig macht und über die Neigung zu Parenthesen in der deutschen Sprache, so dass bei geteilten Verben oft erst am Ende eines
langen Satzes die Auflösung der Satzbedeutung kommt. Und das Partizip ist bis heute die lame dug der deutschen Sprache. Leider wurde gerade dieses Essay aus der Hörfassung gekürzt. Das ist
schade und zugleich verständlich. Ein ironisches Essay über die deutsche Sprache in einer deutschen Übersetzung wirkt allerdings auf mehrfache Weise unfreiwillig komisch. Und ich muss die
Übersetzerin Ana Maria Brock wirklich bewundern, dass sie sich traute, das zu übersetzen. Denn während Twain ironisch deutsche Passagen vorführt, macht die Übersetzung genau dies selbst.
Unvermeidlicher weise natürlich. Es ist, als würde jemand eine Flasche Wein nach der anderen wegputzen und dabei eine flammende Rede gegen den Alkoholismus halten. Insgesamt wirkt diese inzwischen
150 Jahre alte Reiseschilderung eher als ein Sittengemälde aus einer Zeit wo der deutsche Student „nur diejenigen Vorlesungen, die seinem erwählten Fachgebiet entsprechen“ besucht, „und den Rest des
Tages hindurch sein Bier trinkt, seinen Hund umher zerrt und es sich allgemein gut gehen lässt“.
Dem Hunde, wenn er gut gezogen, wird selbst ein weiser Mann gewogen. Ja, deine Gunst verdient er ganz und gar er, der Studenten trefflicher Scolar.
So sieht man auf dem Bild unten einen Oberpedell in Tübingen, kontrolliert Studenten in einer Kneipe (mit kläffendem Pudel) – in späteren Karikaturen wurden Student und Pudel, beide mit Pfeife im
Maul dargestellt…
Ein vergnügliches, nicht immer ernstes Buch, das durch die fehlende Grundspannung (Reiseliteratur ist nie besonders spannend) manchmal Mühe macht beim Lesen.
22. Juni 21
Monschau
Von Steffen Kopetzky
Erschienen 2021
im Verlag Rowohlt
„Nun ist die Luft von solchem Spuk so voll, dass niemand weiß, wie er ihn meiden soll.“ So das Eingangszitat aus Goethes berühmtem Faust, aus dem fünften Akt des zweiten Teils, der die Überschrift „Mitternacht“ trägt. Wenn auch ein Tag uns klar vernünftig lacht, in Traumgespinnst verwickelt uns die Nacht; wir kehren froh von junger Flur zurück, ein Vogel krächzt, was krächzt er? Mißgeschick. So deklamiert Faust weiter. Doch die Pforte knarrt und die Sorge tritt herein. Und am Ende der Szene ist Faust vor Sorge erblindet. Allein im Innern leuchtet helles Licht. Der ehemalige Kulturreferent der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm hat in seinem aktuellen Roman die Eifel als Schauplatz gewählt. Nicht zum ersten Mal. Auch sein Roman „Propaganda“ spielt in Monschau, das im zweiten Weltkrieg ein Kriegsgefangenlager für sowjetische Soldaten beherbergte. „Monschau“ ist keine 20 Jahre später der Schauplatz der letzten Pocken-Epidemie in Deutschland. Im Rahmen unserer aktuellen Seuche ist das natürlich ein Homerun. Aber Kopetzky versteht es geschickt von Stuyvesant-Zigaretten bis Kennedy, Mondlandung, Jazz, Sartre und sogar Johannes Mario Simmel, oder Joachim Fuchsberger (Das Halstuch) in das Romangeschehen einzuweben. Von daher und weil es rasant und süffig geschrieben ist, ein angenehmes Leseerlebnis. Unterhaltungsliteratur? Sicher. Und warum auch nicht. Der Epilog bietet aber dann auch dem anspruchsvollen Leser einen abschließenden Genuss und im Topos von Ithaka kommt der griechische Arzt und Hauptheld Nikos Spyridakis heim zu Muttern und bringt auch noch ein hübsches Industriellentöchterchen in die kretische Heimat mit. Aber im Ernst. Der Roman ist gut recherchiert, die eingebaute Liebesgeschichte gehört zur guten Unterhaltung dazu und wirklich toll geschrieben ist der Ausflug des Liebespaares nach Düren. Das groteske Karneval, und Nikos Geschichte vom Schlachtfest von Kondomari hat Tarantino-Qualität, als sich das 28. oder Māori-Bataillon, bestehend aus 17.000 Maori-Kriegern an den Deutschen rächte, für deren Kriegsverbrechen durch das III. Bataillon (Fallschirmjäger). Diese führten Massenerschießungen durch in Kondomari. Im Kontext der in dieser Zeit noch frischen Kriegserinnerungen sind die Pocken vielleicht ein kleiner Wermutstropfen auf den brodelnden Geschichtsstein. Aber der aufopfernde Kampf von Stüttgen und Nikos, um die Epidemie einzudämmen, berührt. Immer ist es ein auch ein Kampf gegen den Aberglauben oder Unglauben der Menschen (von Aberglauben früh und spat umgarnt…), ein Kampf gegen die Interessen von Wirtschaftsvertretern und ihren alten Naziseilschaften – Kopetzky spielt auf die Otto Junker GmbH an, mit Sitz in Simmerath.
Gelegentlich war der Erzählfluss etwas zu polyhistorisch, es wurde mehr erzählt als gezeigt,
aber Kopetzky bekommt dann doch immer wieder rechtzeitig die Kurve. Sympathische Figuren wie den Fahrer Behrends mit seinen verlorenen Fingern, oder die Altnazi-Figur Lembke, der als bissiger
Hund von Seuss (ein Bajuware im Wortsinn) aufgehetzt wird, Seuss‘ Gegenschlagkoffer mit der Nazi-Droge Pervetin oder dem Kupfervitriol aus der alten Alchimistenküche, mit dessen Hilfe sich Seuss von
zu vielem fettem Essen befreit, und immer wieder Goethe. Goethe, weil dieser Geheimrat gemeinsam mit Christoph Wilhelm Hufeland (Vitalismus, Makrobiotik) die „sanfte Medizin“ einführte und die ersten
Impfungen gegen Variolen organisierte. Goethe war selbst betroffen gewesen, hatte die Pocken überstanden und war daher engagiert genug. Damals impfte man noch lebende Kuhpocken, martialisch. Aber ein
großer Fortschritt; waren doch um die Jahrhundertwende zum 19. Jahrhundert die meisten Ärzte nur zum Aderlass fähig. Heute gelten die Pocken als besiegt, ausgerottet, nicht zuletzt dank der
Massenimpfung. Heute haben wir nun innerhalb eines halben Jahres, seit am 8. Dezember 2020 Margerete Keenan als erste geimpft wurde, bereits zwei Milliarden Impfungen durchgeführt. Eine der größten
Friedensaktionen die es je gegeben hat. Manche Wissenschaftler haben diese Leistung tatsächlich schon mit der Mondlandung verglichen.
Mit dem Beginn des Massenflugzeitalters in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts entstand eine neue Situation. Die Monschauer Pocken waren via Karachi mit Air India und Lufhansa angereist, und
seitdem versuchte man, sie einzufangen. Und hatte dazu zunächst keine anderen Mittel als zu Vorzeiten, als man in den St.-Lazarus-Häusern, Leprosorien und Pestkolonien eine Infrastruktur von
Quarantäne- und Isolationsorten schuf. So beschreibt es Kopetzky (S. 268) und heute las ich in der Zeitung, dass Donald Trump vorhatte, Infizierte nach Guantanamo zu bringen. Aber was hatte der
„best of hairstyle-President“ nicht alles vor? Vor hundert Jahren trank Herr Pettenkofer mit Cholera verseuchtes Wasser um zu beweisen, dass das unschädlich ist wenn man sich gesund ernährt. Von
Pettenkofer kommt der berühmte Ausspruch: „Ich würde ja gerne auch Kontagionist (Robort Koch glaubte an die Infektion) werden, die Ansicht ist ja so bequem und erspart alles weitere
Nachdenken“.
Heute ist der Impfausweis Requisite gesellschaftlicher Teilhabe und Gott allein weiß, ob das zum Standard wird und zwei Impfungen pro Jahr zur normalen Gesundheitsvorsorge.
Aber das sind nur Nebengedanken zum Roman, der ein historisches Ereignis als Metapher nutzt. Hier war es nur ein kleiner Ort in der Eifel. Heute ist es die ganze Welt. Seit 15 Monaten Dauerthema in den Medien (wann gab es das schon mal, dass ein Thema sich so lange halten kann?).
Steffen Kopetzky ist studierter Romanist und Philosoph (in München LMU), ist kommunalpolitisch engagiert und war einige Jahre künstlerischer Leiter der Bonner Biennale. Nicht ganz umsonst hat auch Joseph Boys im Epilog noch seinen Auftritt. Kunst als soziales Engagement. Und das ist nicht ganz ungefährlich. Künstler sind nicht immer die besten Analytiker, weil sie zu viel Phantasie haben. Eine gute Mischung aus Unterhaltung, historische Information, Suchbild (wer ist Grünwald? Ah, Simmel!) war der Roman in jedem Fall.
Nicht immer waren die Dialoge mitreißend, aber auch das habe ich überlesen, lieferte der Stoff selbst doch genügend selbstreferenzielle Ansätze. So habe ich beim Schreiben dieser Besprechung „Also sprach Zarathustra“ angehört, denn das war ein schöner Witz von Kopetzky, dass die Haustür-Klingel von Seuss mit den Anfangstönen der Ouvertüre erschall. Da musste ich natürlich auch an Odyssee 2001 denken und die irritierten Affen, als sie dem Monolith gegenüber standen und was dann geschah….
Eine griechische Tragödie war es natürlich nicht, aber das war auch nicht die Absicht von Kopetzky – denke ich zumindest.
01. Juni 21
Reise um die Welt
Von Mark Twain
Aus dem Amerikanischen von Margarete Jacobi
Erschienen 2011 im Verlag Anaconda
Gott hat den Menschen erschaffen, weil er vom Affen enttäuscht war. Danach hat er auf
weitere Experimente verzichtet.
Es ist natürlich leicht, die Besprechung eines Buches von Mark Twain mit einem treffenden Zitat zu beginnen. Nein! Ist es
gar nicht. Denn es gibt davon so viele, dass man Probleme bekommt in der Auswahl. Ich hätte auch dieses Zitat als Aufmacher nehmen können: Der Mensch ist ein religiöses Tier. Er ist das einzige
Tier, das seinen Nächsten wie sich selber liebt und, wenn dessen Theologie nicht stimmt, ihm die Kehle durchschneidet. Mark Twain erblickte als Samuel Langhorne Clemens 1835 in Florida, Missouri
das Licht der Welt. Er besuchte nur ein paar Jahre die Volksschule und begann im Alter von 11 Jahren seine Ausbildung zum Schriftsetzer. Dem Umgang mit Gedrucktem blieb er treu. In seinen Zwanzigern
war er Lotse auf einem Missipidampfer und aus dieser Zeit stammt sein Pseudonym. Mark Twain, zwei Faden tief, mark two, durch den Dialekt in mark twain verwandelt, musste der Mississippi schon haben,
damit das Dampfschiff nicht auf Grund läuft. Beinahe wäre Mark Twain im Alter von 60 Jahren auf Grund gelaufen durch den Kauf einer fehlerhaften Setzmaschine. Er hatte danach Schulden von 200.000
Dollar und schwor sich, alles auf den Cent zurückzuzahlen. Er war bereits ein berühmter Autor und seine Lesereise wurde daher auch fürstlich entlohnt. Sie führte ihn durch Europa und durch die Länder
des Britisch Empire. Letztere liegen uns hier in der Reprint-Ausgabe des Anaconda-Verlags vor. Australien, Tasmanien, Neuseeland, Indien und Südafrika. Alles koloniale Beuteländer Englands.
Mark Twain spart nicht mit ironischen, sarkastischen Seitenhieben auf diese englischen Besatzer. Man wünscht sich heute noch so eindeutige Antirassisten wie ihn. Zumal er sogar ein gutes Gespür für
den so genannten „positiven Rassismus“ hat. So zitiert er einmal den Erweckungsprediger Charles Chauncy (S. 188): Chauncy spricht voll Bewunderung von der Geduld, der Geschicklichkeit und
wachsamen Klugheit des Eingeborenen… Das wäre etwas für unsern Fenimore Cooper gewesen!“ Twain erwähnt den Lederstrumpf-Autor (gelobt von Goethe), da er ihm eine längere negative Kritik
widmete (The Literary Offenses of James Fenimore Cooper ). Darin karikiert Twain die aberwitzigen und von Zufällen bestimmte Handlung, sowie die grotesken und gekünstelten Dialoge des
Lederstrumpf-Autors Cooper. In der Lobeshymne des Erweckungsgeistlichen entsteht so ein glorifizierendes Bild des „edlen Wilden“, das wir noch in der Bildmetaphorik einer Leni Riefenstahl aus ihrer
Sudanreise kennen. Mark Twain blickt da etwas nüchterner auf die einheimische Bevölkerung der bereisten Länder. Ausrottung und Zerstörung der Lebensgrundlagen stellt er überall fest. Dabei geht es
nicht immer irrational und rassistisch zu. Die Geschichte der Thuggee (ein Lehnwort aus dem Sanskritwort für Betrüger) erzählt er mit kritischem Seitenblick auf deren Zerstörer Henry Sleeman
ausgesprochen differenziert.
Dem Menschengeschlecht im Großen und Ganzen ist die Mordgier eigen, es ergötzt sich am Töten lebender Geschöpfe wie an einem Schauspiel. Wir weißen Leute sind nur etwas verfeinerte Thugs, denen
ihr dünner Anstrich von Zivilisation wie ein lästiger Zwang erscheint. Diese pessimistisch klingende Erkenntnis von Mark Twain lässt sich heute noch unterstreichen. Das Töten als Schauspiel. Im
21. Jahrhundert in einem Münchner Viertel, schaut sich ein erwachsener, gut ausgebildeter Mann, der Frau und Kinder innig liebt Armee of the Death von Zack Snyder an und genießt zweieinhalb
Stunden lang ein fürchterliches, blutiges Gemetzel. Kurz danach, vor dem Zubettgehen, küsst er seine Frau und sieht noch mal nach den Kindern. Der Firniss unserer Zivilisation ist so dünn wie ein
Flachbildfernseher.
Die mehr als nur beeindruckenden Schilderungen seiner Indien-Reise gipfeln im religiösen Zentrum in Benares, 800 Kilometer östlich von Delhi gelegen. Die Hindu-Hochburg gilt als Stadt des Gottes
Shiva und an den Ghats stehen bis heute die Menschenmengen. Mit dem klugen Blick eines Ethnologen beschreibt Twain die Tradition der Witwenverbrennung. Diese Diskussionen führen wir bis heute. Unter
dem Gesichtspunkt relativistischer Ethnologie müssen wir unseren apodiktischen Anspruch überdenken, dass die Aufklärung und die Weiterentwicklung der Naturrechts-Lehren auf der ganzen Welt Gültigkeit
hätten. Die Civitas Humana der Römer geht auf die Stoa von Seneca zurück und bezieht sich in erster Linie auf die militärische Ordnung und Disziplin. Der Renaissance-Gedanke einer universellen
Gerechtigkeit wäre ohne den christlichen Chiliasmus nicht denkbar gewesen. In der Antike gab es diesen Gedanken einer universellen Gerechtigkeit nicht. Ich erwähne das nur deshalb, weil es sich
leicht dahin sagt, dass der Firniss der menschlichen Zivilisation dünn sei. Ist er nicht sogar sehr dick? Die deutsche Gesetzgebung kennt 80.000 Paragrafen! Das ist doch recht ordentlich! Daher warne
ich vor den Schlüssen, die Mark Twain zieht. Er würde mir jedoch Recht geben, wenn ich sage, dass der Mensch ein zu kompliziertes Lebewesen ist (jedes Lebewesen ist übrigens kompliziert aus einer
gewissen Perspektive), um ihm mit einem gut gesagten Aphorismus gerecht werden zu können. Die Diversität schildert Mark Twain ja ausführlich. Und er hat trotz seiner Schicksalsschläge nie seinen
Humor verloren. Allein die Binnenerzählung von dem Mark-Twain-Club und seinem angeblichen Tod ist zu köstlich. Seine beliebte Scharfzüngigkeit steht in der aufklärerischen Tradition eines David Hume,
dessen Reisejournal von 1748 höchst bösartige aber sehr feine Beobachtungen über das deutsche Wesen beinhaltet. Mark Twain ist kein Humboldt. Seine Erzählungen sind persönlicher und anekdotischer.
Heute stehen Autoren wie Hape Kerkeling noch in dieser Tradition der Reiseschilderung. Während sich Humboldt im Baedeker auflöste, packt man Mark Twain heute in einen Rucksack und trägt Sandalen
während der gesamten Reise. Wirklich gute Reiseliteratur erlebt man dann eher in den modernen Medien wie in Reiseblogs. Da bilden dann Fotografien, kleine Smartfilmchen und Familiensmileys den
traurigen Rest einer völlig zerreisten Welt. Zugeben: Ich bin kein Freund der Traveller. Tourismus halte ich für eine postkoloniale Seuche. Aber das ist ein von mir
geliebtes, eingebildetes Extrem. Ob das Reisen wirklich bildet, hängt ausschließlich vom Reisenden selbst ab. Mark Twain war ein immerzu Reisender. Er war immer in Bewegung. Das ist die einzige Form
des Reisens, die ich voll und ganz akzeptiere, die Form des Nomadentums, einer uns ursprünglich zum Menschen machende Daseinsform. Doch „Urlaub“, was auf das mittelhochdeutsche Substantiv „urloup“
zurück geht und lediglich „Erlaubnis“ bedeutet (die Erlaubnis eines Adeligen, dass man sich entfernen darf), ist für mich die Perversion des Reisens. Ich weiß, ich weiß, damit mache ich mir
keine Freunde. Zumal gerade der / die Deutsche seine / ihre Reisekilometer zur Daseinsberechtigung machte. Mark Twain konnte ich folgen, weil er nie stehen blieb. Einem Urlauber, der seinen
Schweinebraten mit Kraut auf Malle fotografiert und auf Facebook postet erlaube ich nicht, dass er sich aus seinem Heimatdorf entfernt.
Mai 2021
Erste Person Singular
Von Haruki Murakami
Aus dem Japanischen
von Ursula Gräfe
Erschienen 2021 bei DuMont
Geheimnisvolle Tanka-Verse, ein sonderbarer alter Mann in einem Park, eine verschwundene
Jazzplatte die nie existierte, das verlorene Gedächtnis des Bruders einer Freundin (die sich umgebracht hat), eine schlechte Baseball-Mannschaft, eine hässliche Frau die Robert Schumann liebt, ein
sprechender Affe der Frauennamen stiehlt und eine Verwechslung in einer Bar sind die Themen der Ich-Erzählungen von Haruki Murakami. Frauen und Musik sind die beiden zentralen Motive der Sammlung.
Meine Favorit ist in jedem Fall die Geschichte Charlie Parker Plays Bossa Nova. Es erinnerte mich an mein allererstes veröffentlichtes Werk vor knapp 30 Jahren. Es hieß Flatted
Fifth und bedauerte die Tatsache, dass Bird keine Platte mehr gemeinsam mit Dizzy aufnehmen konnte, obwohl es sein Wunsch gewesen war und Dizzy noch Jahre später zu Tränen rührte, wenn er
daran dachte, wie der sterbende Charlie diese Hoffnung zum Ausdruck brachte. Murakami war auch noch ein Teenager, als er in einer Uni-Zeitung eine fiktive Schallplattenkritik veröffentlichte. Charlie
– bereits 1955 an den Folgen seiner Heroin-Sucht verstorben – legte dort gemeinsam mit Joachim Jobim eine Schallplatte auf, im Jahr 1963. Charlie Parker plays Bossa Nova. Ausgerechnet dieser
fürchterlich unterkühlte Bossa Nova-Sound! Das passt zusammen wie Hund und Katze. Ausgerechnet Jobim, der bei einem verfluchten Deutschen das Klavierspielen lernte. Und dann Charlie! Jobim und Stan
Getz, ja das passte. Aber das fiebrige Abspielen und Notenhetzen des Bebops? Witzig ist, dass Stan Getz den poetischen und schmeichelnden Bossa Nova über einen weißen Gitarristen mit dem Namen
Charlie Byrd kennen lernte. Bird und Byrd. Schwarz und weiß.
Doch insgesamt haben die Geschichten ihren Reiz. Die surrealen Effekte verpuffen ein wenig, weil sie stets mit einem altbewährten Muster arbeiten: Ein ambitionierter Jungautor auf der einen Seite und
ein altbewährter Autor der sich erinnert auf der anderen Seite und dazwischen geheimnisvolle Frauen, sprechende Affen, die Musik und unwahrscheinliche Zusammenhänge. Einmal erzählte ich einem
jüngeren Freund eine sonderbare Geschichte, die ich mit achtzehn erlebt hatte. So beginnt zum Beispiel die zweite Story „Créme de la Créme“, in der dem jungen Murakami im Park ein
geheimnisvoller, konfuzianische anmutender alter Mann begegnet. Es bricht das Unwirkliche in die Wirklichkeit nach den alten Methoden von Edgar Allan Poe, nur weniger unwirklich. Die Realität hat die
zahlenmäßige Überlegenheit auf ihrer Seite. Das Seltsame am Älterwerden ist für mich nicht, dass ich selbst alt geworden bin und mich unvermittelt von einem jungen in einen alten Mann verwandelt
habe. Viel eher überrascht mich, dass Menschen aus meiner Generation plötzlich alte Leute sind…Und dann wandern wir ins Jahr 1964 in die Zeit der Beatles. Im Grunde steht die Musik fest im
Zentrum der Erzählungen. Jazz, Pop, Klassik werden in jeder Geschichte eingearbeitet und verweisen auf das Dichterleben. In der Beatles-Geschichte (der längsten in der Sammlung) verarbeitet Murakami
einen literarischen Klassiker. Die großartige Story „Zahnräder“ von Ryunosuke Akutagawe. Diese Novelle in sechs Kapiteln verarbeitet das Leiden des nach Murakami wohl bekanntesten und bedeutendsten
Autor Japans an der anachronistischen Welt. Es ist kein Zufall, dass Murakami diese Geschichte zitiert, denn nicht nur Kiefernwälder spielen in der Geschichte „Zahnräder“ eine Rolle, sondern es ist
auch eine moderne Geistergeschichte. Dem unter einer Migräne leidenden Ich-Erzähler begegnet ein Mann in einem Regenmantel, wie ein Geist. Später stellt sich heraus, dass sein Schwager sich vor den
Zug geworfen hatte in suizidaler Absicht. Er trug einen gelben Regenmantel, wie der Geist, den der Icherzähler gesehen hatte. Das ist das perfekte Spiegelmotiv zu Murakamis Erzählungen. Wenn unser
Geist in eine Verwirrung gerät, öffnet er sich und wir sehen hinter die Kulissen unserer Realität. Das ist der Job des Dichters.
Haruki Murakami ist ein globalistischer Pseudo-Mystiker, der Exotik auf ein
erträgliches Maß herunterdimmt und gefällig zu erzählen weiß, schreibt Maike Albath für den Deutschlandfunk. Sie war nicht sehr überzeugt und beurteilte vor allem die Machart. Klar. Murakami hat
seine Methoden. Aber was er eigentlich zu sagen hat als Pseudo-Mystik zu diskreditieren? Ist das fair? Sicher. Murakami erzählt uns keine Gotteserlebnisse, kein Johannes vom Kreuz Erscheinen
reinigenden mystischen Feuers. Warum auch? Das wäre heute lächerlich. Was er noch machen kann ist, an der so überzeugenden Realität kleine Zweifel zu streuen. Das ist es auch, was mir immer an ihm
gefallen hat. Keine großen Töne spuckender und mit Feuereifer und verdrehten Augen auftretender Mystiker, sondern ein moderner Mensch, der gerne gute Mucke hört und schöne Frauen liebt. Ist er
gefällig? Klar. Warum nicht? Aber er ist es nicht mehr, wenn man sich einlässt auf diese Ebene. Dann ist sein aktueller Erzählband eine Sammlung routinierter Ensembles, die neun kleine Stiche
verursachen.
Können wir unserer Wahrnehmung trauen? Können wir unserem Urteilsvermögen trauen? Können wir unserer Erinnerung trauen? Können wir unserem Wissen trauen? Können wir der Logik unserer Geschichten
trauen? Es mögen nur kleine und fast zärtliche Zweifel sein, die wir dann als nur Pseudo aus unserem Alltag löschen können. Betrachten wir den Zweifel jedoch genauer,
dann tun sich Abgründe auf, die wir nicht wirklich kontrollieren können. Wir beschönigen unsere Erfahrungen, betten sie in logisch nachvollziehbare Erzählungen und vergessen dabei, dass sie
existenziell sind. Akutagawe hat sich nach der Erzählung „Zahnräder“ umgebracht.
In dem Augenblick hörte ich jemand eilig die Treppe heraufkommen, aber sogleich wieder
hinunter hasten. Ich wusste, dass es meine Frau gewesen war, sprang erschrocken auf und blickte in das halbdunkle Wohnzimmer, das sich unmittelbar neben dem Treppenabsatz befand. Meine Frau lag mit
dem Gesicht auf dem Boden. Sie schien nach Atem zum ringen. Ihre Schultern bebten.
„Was hast du?“
„Ach, nichts…“
Endlich hob sie den Kopf, lächelte gezwungen und fuhr fort: „Es ist ja nichts geschehen. Aber mir war auf einmal so, als wärst du tot…“
Das war das Schrecklichste, was mir je in meinem Leben widerfahren ist. – ich habe nicht mehr die Kraft weiterzuschreiben. Es ist eine unsägliche Qual, mit diesem Gefühl zu leben. Findet sich denn
niemand, der mich im Schlaf sacht erdrosselt?
Man braucht keine „Dunkle-Nacht-Erlebnis“. Es reichen Kleinigkeiten, um in Erklärungsnot zu kommen. Geschichten können
trösten. Aber nicht verhindern, dass wir es nicht verstehen.
April 2021
Am Götterbaum
Von Hans Pleschinski
erschienen im Verlag C. H. Beck 2021
„Der lactosefreie Macciato ohne Koffein“, rief eine Angestellte ihrer Kollegin vom Service
zu.
Dieser Satz ist sicher das High-Light der Heyse-Satire von Hans Pleschinski. Vielleicht hätten etwas mehr Milchzucker und Koffein das Lesevergnügen noch steigern können. Aber im Ernst. Eine biedere
Stadträtin, eine exaltierte (aber letztlich spießige) Schriftstellerin und eine ordentliche Bibliothekarin (die mich gleich an Elisabeth Tworek erinnerte) bewegen sich auf die Paul-Heyse-Villa zu
durch München. Sie treffen auf einen homosexuellen englischen Heyse-Spezialisten und dessen Partner Herrn Deng, der Rammstein über Kopfhörer lauscht und eine strahlend weiße enge Hose trägt.
Eingestreut werden Gedichte von Heyse und biografische Daten. Zwischen 2013 und 2017 tobte der Streit um seine Villa in Maxvorstadt. Vorhaben der Stadträtin ist es, ein Kulturzentrum daraus zu
machen. Pleschinski kreist um die Frage warum Paul Heyse, der erste deutsche Literaturnobelpreisträger und ein weltweit berühmter Autor des 19. Jahrhunderts, in Vergessenheit geriet. Heyse begründete
zudem das literarische Leben in München, empfing viele Gäste und lockte Berühmtheiten an wie Fontane oder Ibsen. Mit dem Aufkommen der Moderne wurde der Dichterfürst Paul Heyse zunehmend zur
Karikatur.
„Deutschlands Dichter“ sitzen am liebsten im Kaffeehaus: Ernst von Wolzogen mit Zigarettenspitze, Max Halbe mit Zwicker und Paul Heyse im Profil. Karikatur aus dem Simplicissimus 1897 von Bruno Paul. (c) Bayerische Staatsbibliothek / Bildarchiv
So wie ihn Pleschinski schildert ist das eigentlich ungerecht. Heyse verfasste das erste Gedicht gegen Tierquälerei und initiierte so Tierschutzvereine. Er war liberal, setzte sich für die Emmanzipation der Frauen ein, unterstützte den sozialistischen Autor Albert Dulk, als dieser eingesperrt wurde. Der Binnenraum des Romans aber wird von einem lauten und rücksichtslosen Münchner Stadtleben geprägt, von einer bedrohten und ausgelaugten Welt. Gegen Ende des Romans sitzen die Protagonisten schon reichlich erschöpft in einem Studentencafe (Von&Zu), die Schriftstellerin Vandervelt beobachtet die jungen Menschen und stellt sich die Frage, wer diese Generation und die Nachwachsenden noch brauchte, was dieser Jungend verheißen würde? Alles, was jemand benötigte, schien bereits erfunden und vorhanden zu sein. Die Welt war abgeschritten, schien fertig erkundet, gründlich ausgelaugt. Die Vorräte wurden verzehrt. Der Fortschritt, falls man ihn überhaupt wollte, ließe sich bestenfalls glimpflich gestalten. Mehrfach erwähnt Pleschinski Heyses Glück, vor dem Ausbruch des ersten Weltkriegs verstorben zu sein. Heyse, der Weltbürger, erlebt den Zusammenbruch dieser Welt nicht mehr, starb mehr oder weniger glücklich vor dem endgültigen Ende seines 19. Jahrhunderts. Märzrevolution und Gründerepoche prägten den zweiten Goethe Deutschlands. Niemand liest ihn noch. Wehmut klingt an. Deng hört Rammstein. Die Passanten kreisen um ihre eigene kleine Welt. Der Alltag zerstört die schöne Poesie. Gut so weit. Oder eben nicht. Der Spezialist Harald Bradford hat alles von Heyse gelesen, kann teilweise auswendig zitieren, ansonsten hat er alle Texte auf seinem Laptop abrufbereit. Romane, Dramen, Gedichte, und 177 Novellen. Seine Falkentheorie – Konzentration auf das Grundmotiv, und das so genannte Dingsymbol als Leitmotiv - ist Schulstoff.
Leider fehlte dem Roman eine gewisse Grundspannung, da Pleschinski sich ganz auf seine Idee
verließ, eine versunkene Epoche im hektischen Strudel der Zeit wieder zu finden. Denn er fand sie nicht. Sie taucht nicht auf. Da half auch das eingestreute „Gewitter-Kapitel“ nicht. Pleschinski
erzählt gefällig. Nicht immer ist ganz klar, wer der Erzähler ist, denn immer wieder blickt ein externer Erzähler auf die Protagonisten. Das ist jetzt nicht weiter schlimm und die unklare Diegese
störte eigentlich auch kaum, nur immer mal wieder. Vor allem berichtende Zusammenfassungen klangen ein wenig nach Wikipedia-Wissen. Die vielen eingestreuten Gedichte wirkten schon ein wenig aus der
Zeit gefallen. Aber vielleicht wollte Pleschinski auch genau diesen Eindruck erzeugen. Paul Heyse ist aus der Zeit gefallen. Sollte man ihn wieder rein holen? Natürlich. Doch das war auch eine Frage
die mir bei der Lektüre aufleuchtete. Was macht die Bedeutung eines Dichters aus? Warum gerade jetzt Paul Heyse? Wegen der Villa? Die Sache scheint inzwischen geklärt. Oder quält hier eher eine ewige
Frage, die auch Ortrud Vandervelt umtreibt und ihre Stukkaturen aus Emotion? Das große Werk, das überdauert? Paul Heyse bekam als erster Deutscher den Literaturnobelpreis! Er gründete
literarisches Leben in München! Er entdeckte den Biergarten als philosophischen Ort! Und trotzdem, trotzdem gibt es nur eine fürchterlich nach Abgasen stinkende, sehr hässliche Unterführung, die
seinen Namen trägt. Warum überlebte Thomas Mann? Warum Goethe? Warum Fontane? Das lässt sich nicht leicht begründen. Haben die Erwähnten alle besser geschrieben als Paul Heyse? Oder hatten sie
Bedeutenderes zu sagen? Eher nicht. Da liegen sie doch alle mehr oder weniger vom Geschmack getragen, gleichauf. Paul Heyse war von all den Genannten der Berühmteste und am meisten Gelesene.
Weltweit! Oder sind das eh nur Flausen und nichts ist mehr von Bedeutung. Alle Literatur ist nur Treibgut und wird von chaotischen Wellen der Geschichte hin und her getrieben, mal an Land gespült und
wieder weg ins weite, offene Meer? Wer kennt noch Friedrich Spielhagen, Felix Dahn? Wissenschaftler, die sich für eine Habilitation mit ihnen herumschlagen, so wie Harald Bradford: „Sie
Meinen“, Bradford sammelte sich, „ich hätte mein Leben, mein Forschen, mein Lehren, mein innerstes Interesse, meine Sympathie an einen Unwürdigen verschwendet?“
Von März 2018 bis Januar 2019 hielt ich einmal für die Münchner Volkshochschule eine Vortragsreihe über Goethes Faust. Ich ertrank förmlich in Sekundärliteratur. Es waren 24 Abende und es entstand
ein Gesamttext von über 400 Seiten zu den 11.000 Versen des Herrn Geheimrats. Ein großer Tropfen Schweiß für ein paar Hundert Euro. Auch unser Autor Hans Pleschinski hat viel recherchiert und viele
Stunden für seinen Roman gearbeitet. Wäre mal interessant die Arbeitszeit die er dafür aufbrachte in Form eines Stundenlohns darzustellen. Meine Lesezeit betrug etwa 14 Stunden insgesamt, dazu eigene
Recherchen über Heyse, über Geibel und andere. So fand ich jene hübschen Zeilen von Heinrich Mann, der über den Mentor von Paul Heyse Emanuel Geibel folgendes dichtete:
Ihr habt euch stets nur wenig
Beschäftigt mit Literatur,
Drum habt ihr auch vom Verständnis
Der Dichter keine Spur.
Man setzt, um ihn nicht zu vergessen,
Ein Denkmal manch elendem Wicht,
Doch ist das bei ihm nicht nötig -
Einen Heine vergisst man nicht! -
Tja. Einen Heine vergisst man nicht. Aber einen Geibel, Dahn, Spielhagen, Heyse…? Aber warum denn eigentlich? So richtig beantworten kann diese Frage keiner.
26. März 2021
Der Mann im roten Rock
Von Julian Barnes
Aus dem Englischen von Gertraude Krueger
Erschienen 2021 im Verlag Kiepenheuer & Witsch
Ein Graf, ein Prinz und ein Bürger reisen gemeinsam nach London um dort zu shoppen. Neben
diesem „seltsamen Trio“ begegnen uns auch eine Menge junge Leute, die in auffälliger Bekleidung Kirche oder Jahrmarkt besuchen (so beschreibt Wikipedia den Dandy). Wir erleben in dem neuen
Prosawerk von Julian Barnes das 19. Jahrhundert auf seinem personalen Höhepunkt. Von Oskar Wilde bis Beau Brummell. Von Jean Lorrain bis Marcel Proust. Von Huysmans bis Barbey d’Aurevilly. Von Sarah
Bernhardt bis zur Comtesse de Noialles. Von Dreyfusianern und Antidreyfusianern ist die Rede, von den Leidenschaften für das Duell bis zum Satanismus. Julian Barnes hat ein eigenwilliges und höchst
charmantes Stimmungsbild dieses französischen 19. Jahrhunderts geschaffen in dessen Mittelpunkt drei miteinander befreundete Männer. Ein Buch voller herrlicher, lustvoller Anekdoten, Betrachtungen
zur Geschichte und Geschichten zur Betrachtung. Hauptfigur ist der Gynäkologe und Don Juan Samuel Pozzi (1846 – 1918), über den es zur Stunde nur in der englischen Ausgabe von Wikipedia einen Eintrag
gibt. Pozzi war ein Bürgertypus der Gründerepoche, bärtig, tatkräftig und erfolgreich. Erfolgreich im Beruf und bei den Frauen. Seinem offenen und immer neugierigen Charakter, fortschrittlich – wie
es dieser Zeit entsprach – ist es zu verdanken, dass er mit zahlreichen, auch den eigenwilligsten Menschen verkehrte und befreundet war. Genauer beschreibt Julian Barnes den Grafen Robert de
Montesquiou (mit vollem Namen: Marie Joseph Robert Anatole Comte de Montesquiou-Fezensac) und den Prinzen Edmond de Polignac (mit vollem Namen: Edmond Melchior Jean Marie Prince de Polignac).
Der Prinz ist „ein stillgelegter Kerker, der in eine Bibliothek verwandelt wurde“ (Marcel Proust) und bleibt insgesamt die blasseste Erscheinung in Barnes Kabinett. Montesquiou glänzt durch
seine Arroganz mehr als durch Brillanz. Sein Portrait von Giovanni Boldini zeigt einen Mann von etwa vierzig Jahren, der lieber seinen Stock betrachtet und befühlt, als Anteil zu nehmen am Schicksal
der Menschen. Wirklich warmherzige Worte fand er wohl nur für seinen Leibarzt. Und Pozzi ist zweifelsfrei die alles tragende Kraft. Montesquiou ist daher auch mehr eine literarische Figur
(Huysmans Gegen den Strich, und Jean Lorrains Monsieur de Phocas). Pozzi, Darwinist und Fürsprecher Dreyfus‘. Pozzi der Frauenheld und Frauenversteher, dessen Ehe dennoch scheitert
ebenso die Beziehung zu seiner Tochter Catherine Pozzi. Pozzi ist immer da, ist überall.
Barnes mäandert durch die Zeit. So brauchte ich ein paar Seiten zu verstehen, dass ein Absatz bereits ausreicht, um mich in eine andere Welt zu katapultieren. Die Belle Époque, das Fin de Siècle, die
Zeit zwischen dem deutsch-französischen Krieg und dem ersten Weltkrieg erscheint wie eine Verlängerung des Jahrhunderts, das die Historiker gerne als „langes 19. Jahrhundert“ (Eric Hobsbawn)
bezeichnen. Es geht von 1789 bis 1914. 125 Jahre in denen Aufklärung, Industrialisierung, Verstädterung und Verbürgerlichung in das 20. Jahrhundert führten, das – wage ich mal zu behaupten – 2020
endete. Barnes erzählt diesen letzten Abschnitt des langen Jahrhunderts nicht wie ein Historiker, sondern wie ein Romancier. Es sind die Typen, die Figuren und ihre Handlungen. Auch daher weiß Barnes
um die Fiktionalität des Faktischen und reflektiert immer wieder darüber, dass Geschichte auch nur Geschichten sind. „Die Legende trägt immer den Sieg über die historische Wahrheit davon“ erwähnt
Barnes ein Bonmot von Sarah Bernhardt, der nymphomanen Schauspielerin, die am Ende nur noch ein Bein zur Verfügung hat, um den Hamlet zu spielen. Ein Bein, das lange Zeit in der anatomischen Fakultät
in Bordeaux lag, neben dem Fötus siamesischer Zwillinge. Doch vermutlich war es gar nicht das Bein von Sarah Bernhardt, hatte es sich doch von einem rechten in ein linkes Bein verwandelt. Auch fehlte
dem ausgestellten Exponat ein großer Zeh. Das zeigt eben an, wie leicht Geschichte und Geschichten verschmelzen können. Es ist kein neues Problem, das im Diskurs (Genette) liegt. Geschichte begreift
man nicht nur in einer chronologischen Abfolge von Zahlen. Wer die Lebensdaten von Königen aufzählen kann, wer die Daten von Kriegsereignissen aufzählen kann, hat erst mal noch nichts von Geschichte
begriffen. Der Diskurs über einen historischen Zeitraum lässt sich in verschiedene semiotische Systeme übersetzen. Das ist kein Sprachproblem, sondern ein Strukturproblem. In einem jüngsten
Polizeibericht las ich folgendes Ereignis: Am Samstag, 20.03.2021, gegen 17:25 Uhr, fuhr eine 80-jährige Münchnerin mit ihrem Ford auf der Ratoldstraße stadtauswärts. An der
Kreuzung zur Bernhardstraße wollte sie geradeaus weiterfahren. Zum gleichen Zeitpunkt überquerte dort eine 28-jährige Münchnerin als Fußgängerin den dortigen Fußgängerüberweg. Dieses sehr
traurige Ereignis klingt ganz anders, wenn man das semiotische System wechselt:
Es fuhr einst eine alte Frau in ihrem Ford
stadtauswärts aus dem Ort
eine junge ging die Kreuzung hinüber
die alte Frau mit ihrem Ford fuhr einfach drüber
jetzt ist sie tot, die junge Frau unterm Ford
Ähnliches schildert Barnes wiederholt, wenn er den Künstler und sein Portrait in den Blick
nimmt. So zitiert er den Maler Basil Hallwand: Jedes Portrait, das mit Gefühl gemalt ist, ist ein Bildnis des Künstlers, nicht des Modells. Die ganze Geschichte ist nur der Anlass für die
Geschichte die man darüber erzählt. Zugleich macht sich Barnes über diese Exaltiertheit lustig. Aber Freud wäre nicht so weit gegangen zu sagen, wenn er einen weiblichen Akt mit gespreizten
Beinen male, dann ‚offenbare er sich selbst‘. Wenn man sich mit Geschichte beschäftigt und zusätzlich – wie Julian Barnes – über eine reichhaltige Detailkenntnis verfügt, braucht man eine
Struktur. Und diese Struktur verändert die Realität. Der Blick in die Vergangenheit ändert die Vergangenheit. Barnes nutzte daher eine rhizomatische Struktur (Deleuze / Guatarri): Zwischen den
Dingen bezeichnet keine lokalisierbare Beziehung, die vom einen zum anderen geht und umgekehrt, oder eine Pendelbewegung, eine transversale Bewegung, die in die eine und die andere Richtung geht, ein
Strom ohne Anfang oder Ende, der seine beiden Ufer unterspült und in der Mitte immer schneller fließt. (Tausend Plateaus)
Und doch verschafft uns jedes gelungene Kunstwerk eine Illusion von „echter Dauer“; also die Illusion von Ewigkeit. Das ist das Geheimnis künstlerischen Wirkens. Barnes hat mich jedenfalls erneut
mitgenommen und dank seines Charmes folgte ich den kenntnisreichen Schichten von Anekdote zu Bonmot, von Histörchen zu Historien, von Klatsch zu tieferen Wahrheiten. Und so habe ich nach der Lektüre
dieses Buches selbst ein differenzierteres Bild dieser Epoche bekommen.
24. Februar 21
Durcheinandertal
Von Friedrich Dürrenmatt
Erschienen 1989 im Verlag Diogenes
Der Gott ohne Bart hatte Humor. Nun, das kann man wohl von dem Gott mit Bart nicht wirklich behaupten. Friedrich Dürrenmatt war schon zu seinen Lebzeiten ein
großer Unzeitgemäßer. Der letzte Expressionist. Seine erzählende Kritik an der Industrialisierung unserer Welt zeigt sich hier als Fremdkörper in einer zurück gebliebenen Dorfkultur. Das Hotel
Waldhaus Vulpera in Graubünden mit 270 Betten ist das Vorbild für Dürrenmatts letzten Roman. Nicht ohne Grund nutzte Dürrenmatt diese Bühne. Denn das Hotel gilt als Wahrzeichen der Belle Époque, der
dekadenten Fin de Siécle. Und Dürrenmatt kannte es persönlich. Die bürgerliche Elite zeigt sich als durch und durch verdorben, korrumpiert und muss am Ende abgefackelt werden. „Abgebrannt“ ist ein
Homonym, mit dem natürlich wunderbare Ironie erzeugt wird für ein Prunk-Hotel mit dem Namen Hotel der Armut.
Die protestantische Moral wird von Dürrenmatt entlarvt, denn Moses Melker ist selbst ein Mörder und zusätzlich ein Dilettant. Der große Alte ist ebenfalls kein Ausbund des Fleißes, sondern nur ein
surreal anmutender Strippenzieher. Wirklich professionell sind die Mörder, die im Winter einquartiert wurden. Die Millionäre bleiben weitestgehend ohne Namen. Der große Alte lebt –mit oder ohne Bart
– in einer Blase. Das Leben selbst bleibt ein Dschungel. Ob es nun von den Behörden oder vom Syndikat kontrolliert wird.
Die Kritik im literarischen Quartett im Oktober 1989 war vernichtend. Klara Obermüller meinte: „Der Roman heißt nicht nur Durcheinandertal, sondern er ist auch ein heilloses Durcheinander.“ Und Helmut Karasek geht sogar noch weiter indem er Dürrematt zitiert, der einmal sagte, dass ein Roman dann zu Ende sei, wenn die Geschichte seine schlimmst mögliche Wendung genommen habe. Dann sagt Karasek: „Wie kommt es, dass ein Autor von niemandem geschützt wird, bevor er seine schlimmst mögliche Wendung nimmt.“ Dann bringt Karasek sogar noch die neue Ehefrau von Dürrenmatt ins Spiel, Charlotte Kerr, weder verwandt noch verschwägert mit dem berühmten Kritiker. Karasek meinte, dies sei eine Frau nach dem Muster: „Friedrich, aufstehen, dichten!“. Der Roman sei daher durch den äußeren Antrieb neuer Liebe herausgeschüttelt worden.
Das „abscheuliche“ (Ranicki) Buch ist von dem gesamten Quartett nicht verstanden worden. Sie machten sich am Ende kaum noch über das Buch lustig, sondern nur noch über den Autor. Das erwähne ich so ausführlich, weil schlechte Literatursendungen im Fernsehen - die ziemlich niveaufrei über angeblich misslungene Literatur schwätzen - sind selbst das Durcheinandertal dessen Durcheinander sie bemängeln. Der Hund Mani (erinnert auch an Money) heißt wie der berühmte Religionsstifter aus dem persischen Sasanidenreich, an dem die ganze Zwei-Schwerter-Theorie noch eines Luthers klebt. Dass die Jagd auf diesen Hund die Geschichte überhaupt ankurbelt entpuppt sich jedoch als eine falsche Fährte. Am Ende war es der Dobermann des Reichsgrafen, der den Portier Wanzenried in den Hintern biss, um die eigentliche Tat, die Vergewaltigung von Elsi zu vertuschen, bzw. überhaupt die Anwesenheit von Mördern im Kurhaus zu verheimlichen. Alles ist auf den Hund gekommen. Und hier kann man sich mal theosophische Gedanken machen darüber, was die englische Bezeichnung „dog“ umgekehrt gelesen bedeutet. Das tat einst Aleister Crowley, der Meister des Bösen.
Das ganze Dorf lebte ursprünglich von dem Kurhaus als Arbeitsplatz und Kunde der Dorfprodukte. Doch von dem modernen Betrieb hatte das Dorf nichts mehr. Finanzkapitalismus und Globalisierung lassen auch uns fast nur noch die Wahl, alles niederzubrennen. Der Lebensdschungel wird kaum noch durchschaut. Lediglich der Hund Mani erkennt noch das Böse. Gekauft hat das Kurhaus die Anwaltskanzlei Raphael, Raphael & Raphael im Auftrag für Swiss Society for Morality, die von einem Altbundesrat gegründet wurde (ohne sein Wissen), dies wiederum im Auftrag eines ominösen Großen Alten. Der Sekretär des Großen Alten versucht, all die Briefe an den angeblichen Weltherrscher zu beantworten, ebenso das Zusammentreffen des Großen Alten mit seinem Stellvertreter oder Gegenspieler Jeremiah Belias in der Antarktis. Die beiden drehen dort je an einer Kaffeemaschine und setzen so die Gestirne in Schwung.
Was die Zusammenhänge auch immer bedeuten könnten, auf den Grund gehen will ihnen sowieso niemand. „Ich sage dir, Gemeindepräsident, unser Land ist das undurchsichtigste Land der Erde. Niemand weiß, wem was gehört und wer mit wem spielt und wer die Karten gemischt hat. Wir tun so, als ob wir ein freies Land wären, dabei sind wir nicht einmal sicher, ob wir uns überhaupt noch gehören.“ In einer Rede zur Verleihung des Gottlieb Duttweiler-Preises an Vaclav Havel am 22.11.1990 meinte Dürrenmatt, dass die Schweizer sich nur in einem Gefängnis wirklich frei fühlen. Es gibt mit diesem Gefängnis nur ein Problem, zu beweisen, dass ein Gefangener frei ist. Denn von außen betrachtet ist ein Gefängnis ein Gefängnis und sein Insasse nicht frei. Nur die Gefängniswärter sind frei, sonst wären sie ja selbst Gefangene. Um also zu beweisen, dass der Schweizer in seinem Gefängnis frei ist, führte die Schweiz die allgemeine Wärterpflicht ein. Jeder Schweizer hat damit den dialektischen Vorteil, dass er gleichzeitig, frei, Gefangener und Wärter ist. Das Gefängnis braucht daher keine Mauern, weil seine Gefangenen Wärter sind und sich selbst bewachen. Da aber so ein dialektisches Leben psychologische Schwierigkeiten impliziert, fühlten sich manche Wärter nicht frei. Daher wurden über die Wärter, die sich nicht frei fühlten Akten angelegt. Der Aktenberg wurde unübersichtlich und es kam heraus, dass die Wärter selbst über sich Akten angelegt hätten. Wenn alle verantwortlich sind, ist keiner verantwortlich. Die ganze Rede mündet in der Paradoxie einer irrationalen Rationalität und die Schweiz wurde ein sicherer Hort inmitten der Katastrophe. Eine Illusion. Genau die Illusion baut jeder Täter auf, ebenso Moses Melker. Als er am Ende bemerkt, dass er nur benutzt wurde (was er – wie der Leser – schon viel früher hätte merken müssen), ist es schon zu spät. Am Ende des Buches erfüllt sich, was sein muss. Alles wird abgefackelt. Die Illusion unserer modernen Welt, einfach weiter wachsen zu können, weiter im Luxus leben zu können, weiter all die netten Dinge tun zu können, die nur auf der Illusion ruhen, es ginge so weiter, all das wird zusammenbrechen. Und Dürrenmatt – das haben die Witzfiguren vom literarischen Quartett damals nicht sehen können oder nicht sehen wollen – hat einen visionären Roman dazu geschrieben, kurz vor dem Zusammenbruch des Ostens und dies als Parabel auf die rationale Verrücktheit des Menschen. Schon Sigmund Freud (der alte Freud) war sich sicher, dass der Depressive ein Realist ist. Ein mit mir befreundeter Psychiater meinte dazu: „Ja. Aber das Problem des Depressiven ist, dass er da nicht mehr rauskommt.“ Wenn der eigene Realitätssinn so stark wird, dass man nicht mehr drüber lachen kann, ist man krank. Aber wenn man wieder drüber lachen kann ist man kein Realist mehr.
19. Januar 2021
Die Stille
Von Don DeLillo
Aus dem amerikanischen Englisch von Frank Heibert
Erschienen 2020 im Verlag Kiepenheuer & Witsch
Dann starrt er in den schwarzen Bildschirm, endet die schmale Novelle von Don DeLillo. Im Zentrum steht der 56. Super Bowl 2022. Das Ereignis ist umrahmt von Shows
und findet immer am ersten Sonntag im Februar statt, hat also sakralen Charakter.
In seinem berühmtesten Roman „Unterwelt“ stand Baseball im Zentrum des Geschehens. Damals war es The Shot Heard Round the World im Jahr 1951 der die postmoderne Geschichte der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts der amerikanischen Gesellschaft einläutete. Die New York Giants gewinnen nach einer dramatischen Aufholjagd mit einem gewaltigen Schlag des Batters Bobby Thomson, der den
Ball in die Zuschauerränge donnerte, den NL Titel.
In dieser Novelle fällt einfach der Strom aus und beendet die großartige zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts mit zwei Jahrzehnten Verzögerung. Der New Yorker (1936 geboren in der Bronx)
Don DeLillo wurde von dem Ranicki der USA Harold Bloom neben Pynchon und Roth auf den großen Sockel der epochalen Autoren gestellt. Mit einem „Schuss der um die ganze Welt zu hören war begann
alles und mit einer schwarzen Fläche auf einem Megabildschirm endet alles. Wir starren nur noch auf Bildschirme, sind selbst zu Nummern geworden und kommentieren uns nur noch selbst. Dieses
gigantische und überschätzte Selbstgespräch einer nur noch repräsentativen Gesellschaft beendet die große zweite Natur (die Conditio Humana) indem einfach der Stecker gezogen und der Bildschirm
schwarz wird. Die ganze Welt hängt an einer Buchse. Be prepared. Sei bereit, sagen die Pfadfinder und daraus wurden die Prepper. Eine soziopathische Szene aus Rechtsextremen die zusammen mit den
urban riots vor Kurzem das Kapitol stürmten. Der Gedanke an das Ende der Welt eröffnet ein Grandiositätsangebot für Büffelmützen tragende toxische Männlichkeit. Sie sind bewaffnet, tragen
Schutzkleidung und bauen sich Schutzräume, kommunizieren über Funkgeräte, horten Lebensmittel und Medikamente. Be prepared.
Die Realität sieht anders aus. Alles andere als grandios, eher ein wenig lächerlich, aber im
Großen und Ganzen traurig. Jim und Tessa überleben mit Glück die Landung des Flugzeugs und Diane und Max sitzen in ihrer Wohnung fest. Martin versucht einen Ausflug. Aber Chaos herrscht auf den
Straßen und niemand hat eine vernünftige Erklärung für das, was gerade geschieht. Die Zeiten sind pandämonisch.
DeLillo nimmt es mit viel Humor. Max imitiert den Fernseher, Martin ist vom Fußball fasziniert. Zusammenbrechende Mannschaften, der Jubel, die Ekstase. Das alles ist grandios und viele Menschen
können sich noch für Augenblicke identifizieren mit etwas. Doch dann gleiten sie wieder zurück in ihr Nummerndasein. Das bürgerliche Angebot (teilen und monopolisieren) geht mit narzisstischen
Gewinnen sparsam um. Identität ist ein sakraler Luxus. Ansonsten sind wir Bücher lesende Viecher. Aktuell dürfen wir nicht auf die Weide, weil draußen eine Seuche herrscht. Aber solange der
Bildschirm flackert und die bunten Bilder uns umsorgen, müssen wir nicht auf die Weide.
Ansonsten wissen wir nicht viel von den anonymen Mächten. Oder wie es Martin beschreibt: „Guckt euch den schwarzen Bildschirm an. Was versteckt der vor uns?“ Die anonymen Mächte sind wir selbst und der Bildschirm versteckt gar nichts. Aber natürlich steckt im Abbild auch der Abgott. Nach dem Bilderverbot könnte die Zukunft als Bilderverlust geschehen. Diese zweite Natur als Conditio Humana war schon bei Hegel pure Ironie. Sich im Spiegel selbst zu erkennen verbirgt immer die Gefahr, sich selbst im Spiegel zu verkennen. So haben wir die Welt im medialen Spiegel verloren und verwechseln sie tagtäglich mit der Wirklichkeit. Oder nein, wir verwechseln sie nicht, wir können sie gar nicht mehr unterscheiden. Die Wirklichkeit war für den Menschen schon immer nur ein Spiegel. Als man den Kündenden Seher befragte, ob je dieser Knabe zu hohem Alter gelange, da gab er zur Antwort: „Ja, wenn er sich fremd bleibt.“
„Die Welt ist alles, das Individuum nichts. Verstehen wir das alle?“ So Jung-Martin. Aber Max hörte nicht zu. Er starrte weiter in den toten Fernseher. Was man am Ende gesprochen: zurück ertönt das Gehörte. Diese erblickte Narcissus – er schweifte durch weglose Fluren -. Heiß überfällt sie die Liebe: sie folgt seinen Spuren verstohlen, und je mehr sie ihm folgt, je heißer erglüht sie in Flammen. Doch die beiden kommen nie zusammen. Narzissus verschmäht die Nymphe Echo, diese magert aus Kummer derart ab, dass nur noch ihre Stimme übrig bleibt. So trifft ihn ein Fluch. Doch wie den Durst er zu stillen begehrt, erwächst ihm ein andrer Durst: beim Trinken erblickt er herrliche Schönheit; ergriffen liebt er ein körperlos Schemen: was Wasser ist, hält er für Körper.
Diese Verschiebung unserer Libido macht die Welt zum pornografischen Objekt. Wird uns erst
klar, dass das so ist, dann haben wir uns bereits selbst den Stecker gezogen. Das ist die Ironie daran.
Der argentinische Physiker Juan Martin Maldacena (vielleicht ist die Figur Martin eine Anspielung auf ihn) hat die innovativste Entdeckung der jüngeren Physikgeschichte gemacht, die so genannte
AdS/CFT-Korrespondenz, einer Dualität von der gekrümmten Raum/Zeit mit der maxwellschen Feldtheorie. Diese Dualität führt in das holografische Prinzip. Das "holographische Prinzip" besagt, dass
man für die Beschreibung unseres Universums möglicherweise eine Dimension weniger braucht, als es den Anschein hat. Was wir dreidimensional erleben, kann man auch als Abbild von zweidimensionalen
Vorgängen auf einem riesigen kosmischen Horizont betrachten. So gesehen sind wir selbst Bilder die (wenn sie auf einen Bildschirm starren) Bilder betrachten. Wenn wir richtig Pech haben, ist das
gesamte Universum (das bekannte und das unbekannte) insgesamt nur ein Spiegel in einem Spiegel in einem Spiegel.
Das übrigens sagte schon der Neuplatoniker Isaak Lurias im 16. Jahrhundert. In seiner gnostischen Lehre sprach er vom so genannten Tzimzum, einem mystischen Hohlraum der durch die Kontraktion Gottes
entstand. Das so erzeugte Licht ist selbst nichts. So sind wir selbst nur Projektionen – das Individuum ist nichts, die Welt ist eben alles. Doch das wäre eine Katastrophe. Es wäre fatalistisch und
destruktiv. Ein riesiger Super-Bowl für nichts und wieder nichts. Lautes, homerisches Lachen wäre die einzige vernünftige Reaktion auf so einen Irrsinn.
Rufen Sie einfach an unter
Arwed Vogel
++49 ( )8762 726121
oder
Bernhard Horwatitsch
017646130019
horwatitsch[at]gmx.at
...
oder
nutzen Sie unser

















